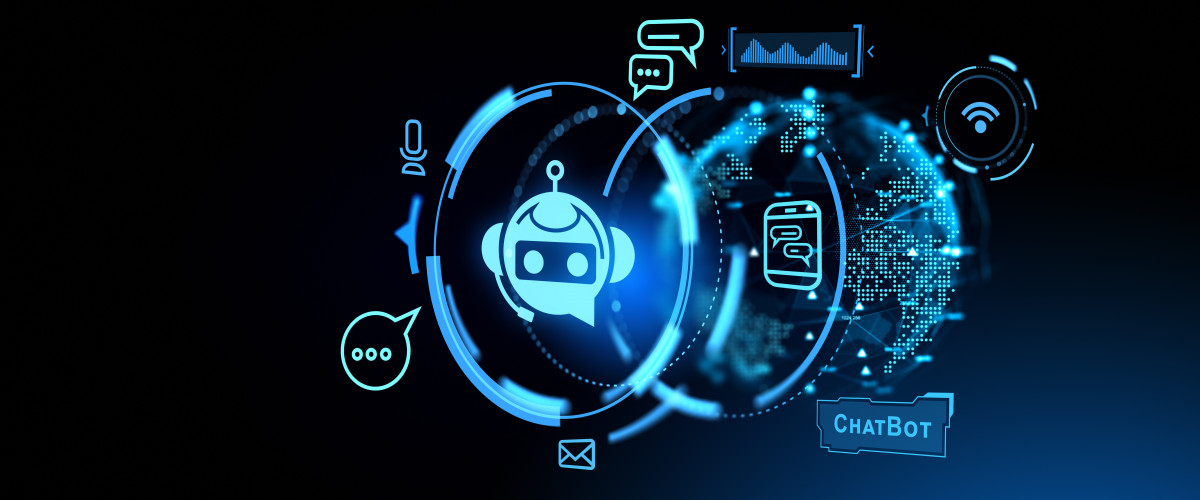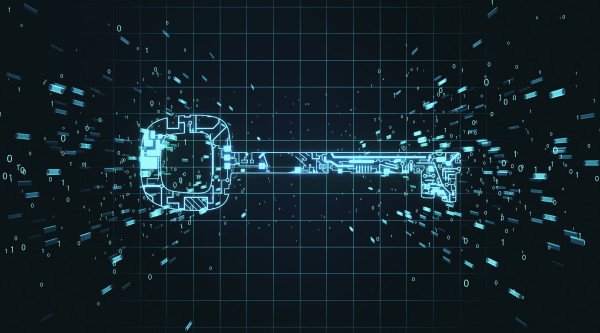Das Sozialgesetzbuch: Grundlage für soziale Leistungen und deren Verwaltung
Das deutsche Sozialgesetzbuch (SGB) ist die zentrale Kodifikation des Sozialrechts in Deutschland1. Seit den 1970er Jahren wird es schrittweise aufgebaut und umfasst heute die wesentlichen Bereiche des Sozialrechts. Das SGB ist in insgesamt 13 Bücher unterteilt, die verschiedene Aspekte des Sozialrechts abdecken, von der Krankenversicherung bis zur Sozialhilfe. Es ist von zentraler Bedeutung für die Gestaltung des Sozialstaats und gewährleistet den Zugang zu Leistungen in den Bereichen Kranken-, Unfall-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung sowie zur Sozialhilfe und Jugendhilfe.
Das Sozialgesetzbuch wurde geschaffen, um eine einheitliche, nachvollziehbare und zeitgemäße Grundlage für soziale Leistungen und deren Verwaltung zu bieten. Es ist im öffentlichen Recht verankert und bindet sowohl die ausführenden Behörden als auch die Leistungsempfängerinnen und -empfänger ein. Trotz seiner Bedeutung ist das SGB nicht ohne Probleme, insbesondere in Bezug auf Barrierefreiheit und Komplexität.
Wer nutzt das Sozialgesetzbuch und wofür?
Das SGB ist für eine Vielzahl von Personen von großer Relevanz2. Dazu gehören:
- Personen, die staatliche Sozialleistungen beziehen oder beantragen möchten, darunter Arbeitsuchende, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen und Rentenbeziehende.
- Arbeitgebende, die sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze anbieten.
- Mitarbeitende in Sozialverwaltungen und Behörden.
- Beratungsstellen und Sozialverbände.
Für diese Gruppen ist es von Vorteil, grundlegende Kenntnisse über das Sozialgesetzbuch zu besitzen, um ihre Rechte und Pflichten besser zu verstehen und effektiv nutzen zu können.
Zusätzlich sind besonders wichtige Akteure die Leistungsträger, die direkt mit dem SGB arbeiten3. Diese Institutionen oder Behörden sind für die Umsetzung der jeweiligen Sozialleistungen zuständig. Sie nehmen Anträge entgegen, prüfen diese, entscheiden über Leistungen und sorgen für die Auszahlung. Zu den wichtigsten Leistungsträgern zählen die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen, Rentenversicherungsträger, Unfallversicherungsträger, Agenturen für Arbeit, Jobcenter und Kommunalverwaltungen.
Trotz der umfassenden Unterstützung, die das SGB bietet, sehen sich Nutzende oft mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Diese Probleme können von bürokratischen Hürden bis hin zu Schwierigkeiten bei der Antragstellung reichen. Besonders betroffen sind dabei Menschen mit Behinderungen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind.
Zugangshürden im Sozialstaat: Sprachliche, strukturelle und digitale Barrieren
Ein zentrales Problem für einen inklusiven und barrierearmen Zugang zu Sozialleistungen ist die komplexe Sprache des Sozialgesetzbuches. Sie ist nicht nur für viele Antragstellende schwer verständlich, sondern stellt auch für Verwaltungsmitarbeitende eine Herausforderung dar. Für Antragstellende sind die häufig verschachtelten, fachsprachlich formulierten Gesetzestexte und Formulare oft schwer verständlich und überfordern viele, auch ohne eine formale Behinderung. Das betrifft nicht nur Menschen mit kognitiven Einschränkungen, sondern eine breite Bevölkerungsgruppe, darunter insbesondere ältere Menschen, Menschen mit geringen Lesekompetenzen oder mangelnden Deutschkenntnissen. Für Verwaltungsmitarbeitende wiederum bedeutet die Vielzahl von spezialgesetzlichen Regelungen und Ausnahmetatbeständen eine hohe fachliche Anforderung, was zu Unsicherheiten oder inkonsistenten Auslegungen führen kann.
Dadurch entstehen Barrieren, die den Zugang zu Sozialleistungen erschweren oder verhindern. Viele Menschen erfahren die Antragstellung als undurchsichtig oder schwer verständlich, was zu Fehlanträgen oder Nichtinanspruchnahme von Leistungen führt.
Eine Studie der Aktion Mensch zu Barrieren im Alltag4 zeigt beispielsweise, dass eine der häufigsten Alltagsbarrieren für Menschen ohne Behinderung komplizierte und schwer verständliche Formulare bei Behörden und Versicherungen sind (28 % der Befragten). Dies zeigt, dass Sprach- und Verständnishürden allgemeine Zugangsprobleme hervorrufen.
Darüber hinaus verdeutlicht eine Studie des IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) aus dem Jahr 20245, dass Jobcenter in Deutschland mit sprachlicher Vielfalt und Verständigungsproblemen insbesondere bei Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchteten konfrontiert sind. Verständnisschwierigkeiten durch komplexe Sprache sind eine zentrale Hürde für den Zugang zu Sozialleistungen – insbesondere für Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Zudem fehlen oft professionelle Dolmetschende, was die Zugänglichkeit weiter einschränkt.
Deshalb ist es entscheidend, dass Informationen in Leichter Sprache oder in Fremdsprachen bereitgestellt werden sowie in zugänglichen Formaten über Ansprüche und Verfahren aufgeklärt wird. So können Sozialleistungen inklusiv und barrierearm gestaltet werden. Das verhindert, dass Leistungen nicht in Anspruch genommen werden. Außerdem wird die Sachbearbeitung für die Mitarbeitenden der Verwaltung erleichtert.
Komplexität des Systems und Struktur des Sozialstaats
Ein weiteres Hindernis im Zugang zu Sozialleistungen ist die Komplexität des deutschen Sozialstaats, welche durch die Vielzahl von Schnittstellen und verschiedenen sozialen Hilfen und Förderungen verstärkt wird.
Fünf Bundesministerien verantworten etwa 170 Leistungen, die von fast 30 Behörden unter Verwendung unterschiedlicher Begrifflichkeiten verwaltet und in 16 Ländern mit 400 kommunalen Gebietskörperschaften teils unterschiedlich umgesetzt werden.
Diese Struktur führt dazu, dass die Verwaltungen mit dem Vollzug überlastet sind und die Anspruchsberechtigten mit den Antragstellungen überfordert werden. Ein anschauliches Beispiel hierfür liefert Peer Steinbrück (SPD), ehemaliger Bundesminister: „Eine alleinerziehende Frau mit einem pflegebedürftigen Vater hat Anspruch auf ungefähr zwölf Sozialleistungen, denen vier verschiedene Einkommensbegriffe zugrunde liegen, und sie muss sich mit acht Bewilligungsstellen befassen.“ 6
Konkret bedeutet das, dass auf die alleinerziehende, pflegende Frau verschiedene Antragstellungen und Behördenkontakte zukommen. Diese reichen von Kinderbetreuungskosten und Alleinerziehendenfreibetrag beim Finanzamt über Kindergeld und Kinderzuschlag bei der Familienkasse bis hin zu Versicherungsleistungen bei der gesetzlichen Pflegekasse.
Diese Fallkonstellation verdeutlicht exemplarisch die Komplexität und die daraus entstehenden strukturellen Hürden im deutschen Sozialleistungssystem. Ohne gezielte Beratung oder erheblichen Eigenaufwand ist es kaum möglich, einen vollständigen Überblick über bestehende Ansprüche zu erlangen.
Die Vielzahl paralleler Verfahren, fehlende behördenübergreifende Prozesse und uneinheitliche Begriffsverwendungen erschweren selbst in vergleichsweise klaren Lebenslagen den Zugang zu Leistungen. Je komplexer die Familiensituation, desto größer wird die Gefahr, dass Leistungen nicht, falsch oder zu spät beantragt werden. Diese systemische Intransparenz führt nicht nur zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand in Ämtern und Behörden, sondern auch zu einer faktischen Leistungsungleichheit. Damit wird die Zielsetzung sozialstaatlicher Gerechtigkeit untergraben.7
Beratungsdefizit und Intransparenz
Eine weitere Zugangshürde im Sozialrecht ist das Beratungsdefizit. Es fehlt an einer ganzheitlichen Beratung an einer zentralen Stelle8. Stattdessen beraten Behörden nur in ihrem jeweiligen Zuständigkeitssektor. Dies führt zu einer unübersichtlichen und intransparenten Struktur, die es den Bürgerinnen und Bürgern erschwert, ihre Ansprüche geltend zu machen.
Ein Beispiel für die Folgen dieser Intransparenz ist die Nichtinanspruchnahme von Leistungen. Groben Schätzungen zufolge wird die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger, die Anspruch auf ergänzende Grundsicherung im Alter haben, vom Hilfesystem nicht erreicht9. Die Quote der Nichtinanspruchnahme unterscheidet sich dabei je nach Bildungsgrad sehr deutlich.
Die Ergebnisse einer Studie zur Nichtinanspruchnahme von Grundsicherungsleistungen der Ernst-Abbe Hochschule Jena aus dem Jahr 202310 verdeutlichen das Problem weiter: Neben dem klaren Wunsch der Befragten nach einer Vereinfachung bürokratischer Hürden im Antragsprozess und einer besseren Digitalisierung der Antragswege erklärten 13 % der Teilnehmenden, dass sie einen Bedarf an besserer Information, Aufklärung und erhöhter Transparenz sehen. Diese Forderungen deuten auf eine weitverbreitete Unkenntnis über die Leistungsmodalitäten in der Bevölkerung hin. Eng damit verbunden ist auch der Wunsch nach verbesserter Beratung und gezielter Unterstützung bei der Antragstellung, den 10 % der Befragten ausdrücklich nannten. In diesem Zusammenhang ist der ausgeprägte Bedarf an persönlicher Beratung besonders auffällig.
In der Summe zeigen diese Befunde, dass die Überwindung des Beratungsdefizits und der Ausbau verständlicher, niedrigschwelliger sowie ganzheitlicher Beratungsangebote entscheidend sind, um die Intransparenz und die Zugangsbarrieren im Sozialrecht abzubauen. Nur so kann gewährleistet werden, dass Anspruchsberechtigte ihre Rechte kennen und auch tatsächlich nutzen können.
Digitale Lösungen zur Bewältigung der Probleme
Die dargestellten Barrieren im Sozialrecht – von sprachlichen Hürden über Systemkomplexität bis hin zum Beratungsdefizit – machen deutlich, dass herkömmliche Verwaltungswege oft nicht ausreichen, um einen barrierefreien und gerechten Zugang zu Sozialleistungen sicherzustellen. Digitale Lösungen bieten hier großes Potenzial, diese Herausforderungen zu überwinden und die Sozialleistungen inklusiver zu gestalten11.
Innovative Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) können die Inhalte der 13 Bücher des SGB schnell analysieren und zusammenfassen. Dies kann dazu beitragen, die Informationen für Bürgerinnen und Bürger sowie Verwaltungsmitarbeitende verständlicher und zugänglicher zu machen.
Auch KI-gestützte Möglichkeiten, Inhalte zum Sozialrecht in Leichte Sprache, Alltagssprache sowie Fremdsprachen zu übersetzen, erleichtern nicht nur den inklusiven und barrierearmen Zugang zu Informationen für Antragstellende, sondern tragen auch dazu bei, den Zugang zu Sozialleistungen und damit soziale Teilhabe gerechter zu gestalten. Zudem können KI-Übersetzungssysteme Sachbearbeitende und Sozialarbeitende deutlich entlasten.
Schließlich entlasten intelligente Assistenzsysteme die Mitarbeitenden in Sozialverwaltungen, indem sie Routineaufgaben automatisieren und Entscheidungsprozesse unterstützen. Das schafft mehr Raum für individuelle Beratung und fördert einen barrierearmen Zugang zu Leistungen für Antragstellende.
Damit digitale Lösungen ihr volles Potenzial entfalten können, sind jedoch begleitende Maßnahmen nötig: der Ausbau der digitalen Infrastruktur, Schulungen für Mitarbeitende, Datenschutzkonzepte sowie klare gesetzliche Rahmenbedingungen. Nur in einem ganzheitlichen Ansatz kann Digitalisierung dazu beitragen, das Sozialrecht barrierefreier und gerechter zu gestalten.
Quellen
1Sozialgesetzbuch (SGB), https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/
2MTR Legal, Sozialgesetzbuch (SGB), 2025,
https://www.mtrlegal.com/wiki/sozialgesetzbuch-sgb/
3Ibid.
4Aktion Mensch, Barrieren im Alltag – wer sie wahrnimmt und wen sie behindern,
Ipsos-Befragung, 2024,
https://delivery-aktion-mensch.stylelabs.cloud/api/public/content/studie-barrieren-im-alltag.pdf?v=f7d93483
5IAB, Kommunikation mit Geflüchteten – Wie Jobcenter mit sprachlicher Diversität umgehen, IAB-Forum, 2024,
https://iab-forum.de/kommunikation-mit-gefluechteten-wie-jobcenter-mit-sprachlicher-diversitaet-umgehen/
6Ibid.
7Deloitte, Wege aus der Komplexitätsfalle. Vereinfachung und Automatisierung von Sozialleistungen, 2024,
Wege aus der Komplexitätsfalle. Vereinfachung und Automatisierung von Sozialleistungen
8LTO, Für ein zugängliches und effizientes Sozialrecht, Plädoyer vom Präsidenten des Landessozialgerichts NRW, 2025,
https://www.lto.de/recht/meinung/m/sozialrecht-komplex-ineffizient-leistungen-zusammenlegen-kommentar
9Ibid.
10Ernst-Abbe-Hochschule, Projektbericht: Nichtinanspruchnahme von Grundsicherungsleistungen, 2022,
https://www.eah-jena.de/fileadmin/user_upload/konferenzen/fachtagung/
Der_weite_Weg_zum_Buergergeld/NVG_Working_Paper_1.pdf
11Deutschland Recht, Revolution im deutschen Recht – Wie juristische KI den Zugang zu Gesetzen vereinfacht, 2025,
https://deutschland-recht.de/juristische-ki-im-einsatz/
Die msg systems ag beim 4. ZuKo Sozialversicherungen
Mensch bleibt Mensch - doch KI stärkt das Soziale!
Die Sozialwirtschaft steht vor enormen Herausforderungen: Der Fachkräftemangel verschärft sich, die Komplexität gesetzlicher Anforderungen – insbesondere im Kontext des Sozialgesetzbuches (SGB) – nimmt stetig zu, und Mitarbeitende verbringen immer mehr Zeit mit administrativen und Rechercheaufgaben statt mit direkter sozialer Arbeit.
Künstliche Intelligenz (KI) bietet hier transformative Potenziale – wenn sie gezielt, verantwortungsvoll und praxisnah eingesetzt wird. Im Vortrag zeigte msg systems ag, wie KI-Systeme heute schon unterstützen können: von der intelligenten Recherche in komplexen Rechtslagen über die Entlastung in der Fallarbeit bis hin zur Wissensaufbereitung für Fachkräfte. Dabei wurden nicht nur technologische Möglichkeiten, sondern auch ethische, rechtliche und organisationale Aspekte eines verantwortungsvollen KI-Einsatzes in der Sozialwirtschaft betrachtet.
Anhand konkreter Beispiele und Anwendungsszenarien wurde diskutiert, wie KI helfen kann, Ressourcen zu schonen, Qualität zu sichern und Fachkräfte zu entlasten – ohne den Menschen aus dem Mittelpunkt sozialer Arbeit zu verdrängen.