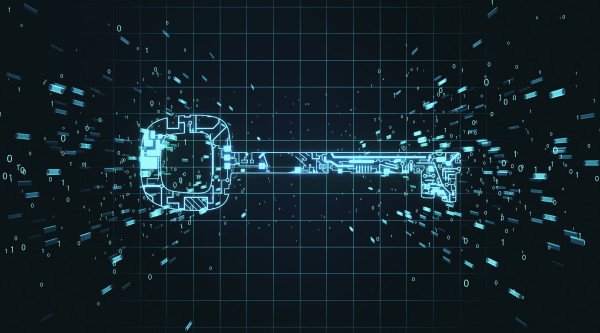Es ist inzwischen der Running Gag der Digitalpolitik: Deutschland liegt im weltweiten E-Government Ranking nur knapp vor Kasachstan. Übrigens: Respekt vor Kasachstan! Regelmäßig, wenn Studien oder Analysen zur Verwaltungsdigitalisierung veröffentlicht werden, gibt es geringe Fortschritte oder im internationalen Vergleich nur Mittelmaß für Deutschland zu beklagen. Der jüngst erschienene eGovernment Monitor der Initiative D21 reiht sich zwanglos ein in die Atteste scheinbaren Versagens der Digitalpolitik. Die Suche nach den Schuldigen bietet dankbare Opfer: Die Digitalisierungsverantwortlichen in Politik und Verwaltung bekommen es einfach nicht hin, von den Softwarelieferanten und IT-Dienstleistern vernünftige, nutzerfreundliche und innovative Lösungen zu erhalten, die dann Bürgern und Unternehmen das Leben leichter machen und Verwaltungsprozesse automatisiert durchlaufen lassen ohne lästige Behördengänge, Wartezeiten und seitenlange Papieranträge. Aber ist es wirklich so einfach? Richtig an der Schuldzuweisung ist, dass die Digitalisierer selbst verantwortlich sind für die Misere. Zu lange haben sie den Eindruck erweckt, die Probleme der Verwaltungsdigitalisierung lösen zu können, wenn nur genug Geld vorhanden wäre, Infrastruktur zu Verfügung stünde und Datenquellen erschlossen würden. Manche Debatte erweckt zudem den Eindruck, man müsse nur konsequent auf Open Source setzen, dann löse sich der Digitalisierungsstau der öffentlichen Verwaltung in Deutschland quasi von allein auf - und digitale Souveränität bekomme man noch als Dreingabe auf dem Silbertablett mit serviert.
Vieles davon ist nicht ganz falsch, lenkt aber vom Kernproblem ab. Zwei Beispiele zeigen die Schieflage der Digitalpolitik in Deutschland schlaglichtartig auf: Beim Deutschen Kommunalkongress Ende Juni erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, der Antrag auf den Personalausweis müsse durchgängig digital möglich sein. Und auf LinkedIn forderte die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach völlig zu Recht, die Anmeldung für die Schulanfänger müsse endlich digital erfolgen. Beide Forderungen klingen für das staunende Publikum wie ein klarer Auftrag an Softwareentwickler für die öffentliche Verwaltung, diese Problemstellung konkret zu lösen. Das ist aber weit gefehlt.
Die für die Digitalisierung Verantwortlichen sind nämlich nur scheinbar zuständig. Tatsächlich richtet sich der Auftrag an die fachlich Verantwortlichen. Die Digitalisierung des Personalausweisantrags scheitert an den Innenministerien. Deren für das Pass- und Ausweiswesen zuständige Fachleute halten nämlich die Überprüfung der Identität mittels persönlicher Inaugenscheinnahme in den Pass- und Ausweisämtern bei der Antragstellung für unerlässlich. Die digitale Schulanmeldung in Bayern scheitert an der Vorschrift in der Bayerischen Grundschulordnung, wonach ein Erziehungsberechtigter persönlich sein Kind bei der Anmeldung in der Schule vorzuführen hat. Und da Kinder bekanntlich nicht durch eine Datenleitung passen, lässt sich der Prozess ohne Rechtsänderung nicht digitalisieren.
Was zeigen die Beispiele? In den allermeisten Fällen lassen sich die Digitalisierungsdefizite der deutschen Verwaltung nicht durch die Fachschaft der Digitalpolitiker oder gar die Digitalisierungsexperten bei IT-Dienstleistern und in den Verwaltungen lösen, sondern zuvorderst von den Fachpolitikern und Fachressorts. Die hochfliegenden Digitalisierungsziele von Digitalräten, Digitalministerien, des IT-Planungsrats – und wie die Gremien alle heißen mögen zerschellen regelmäßig an den analogen Brandmauern, die von den Fachexperten der jeweiligen Provenienz um ihre sorgsam gepflegten Fachbiotope aufgerichtet wurden. Solange Digitalisierung als eine Angelegenheit einer elitären Clique von Verwaltungsnerds betrachtet wird, werden die Konzepte genau dies bleiben: gut gemeinte Zielbeschreibungen aus technologisch-abstrakter Sicht mit wenig Aussicht auf substanzielle Veränderung der Verwaltungsstrukturen in Deutschland. Wir stehen auch in der öffentlichen Verwaltung an der digitalen Schwelle. Digitalisierung ist das künftig Selbstverständliche, sie geht nicht mehr weg, sondern wird für den Rest der Ewigkeit Grundlage des Verwaltungshandelns sein, so wie es Papier Jahrhunderte lang gewesen ist. An dieser digitalen Schwelle müssen wir in unsere Zukunft mehr investieren als bisher. Zudem sollten wir bedenken: Wenn es uns nicht gelingt, binnen einer Frist von höchstens fünf Jahren alle regelgebundenen Verwaltungsprozesse zu automatisieren, werden wir angesichts eines dramatischen Mangels an qualifizierten Kräften im Rahmen der demographischen Entwicklung in der Verwaltung nicht mehr in der Lage sein, die Funktionstüchtigkeit der deutschen Behörden auf allen Ebenen aufrechtzuerhalten. Dazu muss Digitalisierung allerdings zur zentralen Aufgabe und Chefsache in den Staatskanzleien und Ministerien werden. Es wäre ein fataler Fehler, weiter allein auf die Durchsetzungskraft weniger Digitalexperten zu hoffen. Es braucht die Überzeugung und den Mut aller Fachverantwortlichen, heute analoge Prozesse komplett zu überdenken. Dann können die Digitalisierungsexperten ans Werk.
Welche disruptive Kraft solche Entscheidungen entfalten könnten, wird an zwei Beispielen deutlich: Nehmen wir an, der Bundesgesetzgeber schriebe vor, dass die Wohnsitzummeldung künftig ausschließlich digital erfolgen darf. Oder stellen wir uns vor, der Bundesgesetzgeber entschiede, Kfz-Anmeldungen dürften nur noch online durchgeführt werden. Auf den Schlag würden diese Prozesse vollständig automatisiert abgewickelt, sofort würden Tausende Stellen in den Kommunalverwaltungen verfügbar für die Kernaufgaben der Kommunen. Noch mehr Potential steckt in der Überlegung, dass es eine Vielzahl an Verfahren gibt, die heute einen Antrag voraussetzen, aber eigentlich geknüpft an bestimmte Ereignisse ganz automatisch ablaufen könnten. IT-technisch lässt sich das in den bestehenden Systemen problemlos umsetzen. Dazu bedarf es keiner neu entwickelter Fachverfahren, keiner Zuständigkeitsänderung, keiner Milliardeninvestition in Unternehmensberatungen und Systemhäuser. Und die Bürger und Unternehmen würden Tausende Kilometer Fahrten und Tausende Stunden Wartezeit einsparen. Noch einmal: Das sind Entscheidungen nicht von Digitalisierungsverantwortlichen, sondern von Fachexperten. Was zeigen uns die Beispiele? In Zeiten absolutistischer Herrschaft mag es möglich gewesen sein, disruptive Änderungen des staatlichen Handelns zentral von einzelnen Verantwortlichen wie Maximilian Graf Montgelas in Bayern oder Karl Freiherr vom Stein und Karl August von Hardenberg in Preußen durchsetzen zu lassen.
In unserer komplexen Welt ist es naiv zu glauben, einige wenige Digitalpolitiker könnten den Staatsapparat einfach mal so mit einem Streich (heiße er nun OZG 1.0 oder 2.0) auf digital trimmen. Dazu braucht es eine gemeinsame politische, von allen Ressortministern und den Regierungschefs getragene, konsequente und mutige Digitalisierungsagenda und den Willen und die Überzeugung der Fachverantwortlichen in den Ministerien in Bund und Ländern, dass ohne komplette Digitalisierung mindestens aller gebundenen Prozesse die Zukunft unserer Verwaltung und damit die Funktionstüchtigkeit unseres Landes auf dem Spiel steht.
Rudolf Schleyer ist Vorstandsvorsitzender der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB).
Dieser Artikel erschien am 24. November 2022 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung