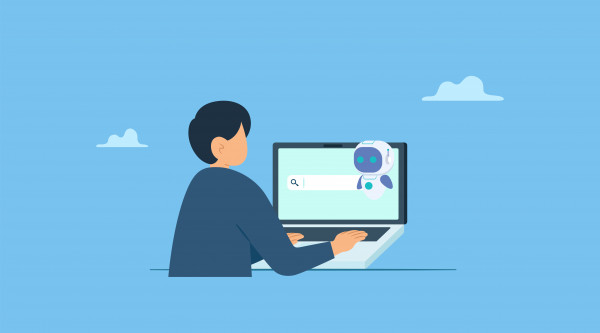Im Kontext von Innovation, Projekten, Veränderung und agilem Arbeiten wird häufig die gern zitierte Fehlerkultur eingefordert oder als notwendige Voraussetzung benannt. An vielen Stellen ist zu lesen, die öffentliche Verwaltung brauche eine Fehlerkultur.
Der Begriff „Fehlerkultur“ beschreibt den Umgang einer Organisation mit Fehlern und die Art und Weise, wie diese kommuniziert, analysiert und behoben werden. Eine konstruktive Fehlerkultur unterscheidet sich grundlegend von einer „Blame Culture“, in der Fehler vertuscht und Schuldige gesucht werden. Soweit so gut, doch was ist eigentlich ein Fehler?
Was ist ein Fehler?
Zunächst, Fehler können nur entstehen, wenn es Regeln gibt. Ohne Regeln - keine Fehler. Ein Fehler ist damit nicht einfach ein unerwünschtes Ergebnis. Er entsteht nur in Bezug auf ein definiertes Ziel, eine Regel oder eine Erwartung. Erst wenn klar ist, was erreicht werden muss oder wie etwas ablaufen muss, kann eine Abweichung davon als Fehler bezeichnet werden. Ohne diesen Referenzrahmen gibt es keine Abweichung und damit auch keinen Fehler im klassischen Sinn.
Regeln schaffen Orientierung und definieren Fehler
Ein Fehler setzt also immer das Vorhandensein eines Regelsystems voraus. Nur wenn es definierte Erwartungen, Normen oder Verfahren gibt, kann eine Abweichung davon als Fehler erkannt und benannt werden.
Regelsysteme wurden und werden geschaffen, um zum Beispiel Stabilität, Verlässlichkeit und Gleichbehandlung sicherzustellen. Regeln strukturieren das Verwaltungshandeln, schaffen Orientierung und ermöglichen die Steuerung komplexer Abläufe. In der öffentlichen Verwaltung erfüllen sie eine zentrale Funktion: Sie gewährleisten rechtsstaatliches Handeln, Nachvollziehbarkeit und Effizienz. Sind nun mehr Fehler in der öffentlichen Verwaltung wünschenswert? Vergabe ohne Ausschreibungsverfahren, ohne Grundlage ausgezahlte Kindergeldbeträge oder Einsichtnahme unbefugter Personen in personenbezogene Daten? Natürlich nicht.
Der idealtypische Verwaltungsbeamte oder -angestellte, nach Vorstellung des Soziologen Max Weber, agiert bestenfalls fehlerlos. Er ist Mitarbeiter eines Systems, welches auf Stabilität und die Befolgung von Vorschriften und Regeln abzielt. Ein Fehler ist hier die Abweichung von der Norm und als solcher zu vermeiden und bei Eintritt zu sanktionieren. Begreiflicherweise führt dies dazu, dass Fehler in solchen Organisationskulturen gerne verheimlicht und Risiken grundsätzlich vermieden werden, unabhängig davon, welches Potenzial dadurch brachliegt.
Wenn das Regelsystem selbst fehlerhaft ist
Wenn nun gegen Regelsysteme verstoßen wird, stellt sich die Frage: Liegt der Fehler bei der ausführenden Person, also im Verhalten, der Kompetenz oder der Sorgfalt oder liegt er im Regelsystem selbst?
Diese Unterscheidung ist entscheidend für eine konstruktive Kultur:
- Liegt der Fehler bei der Person, kann es um eine fehlende Qualifikation, eine unklare Kommunikation, eine Überforderung oder eine bewusste Abweichung gehen. Hier helfen individuelle Rückmeldungen, Weiterbildung oder Unterstützungssysteme, Sanktionen nur bei Vorsatz.
- Liegt der Fehler im Regelsystem, dann war die Regel vielleicht unklar, widersprüchlich, veraltet oder in der Praxis nicht anwendbar. In diesem Fall ist der sogenannte „Fehler“ ein wichtiger Hinweis auf Änderungsbedarf im System selbst.
Wird ein Fehler sichtbar, lohnt sich der systemische Blick: Handelt es sich um individuelles Fehlverhalten oder zeigt sich an dieser Stelle, dass ein Prozess, eine Regel oder ein Ziel überdacht werden sollte? Gerade in komplexen Organisationen wie der öffentlichen Verwaltung ist es zielführender, nicht bei der Symptombehandlung zu bleiben, sondern die Ursachen zu verstehen. So kann ein Fehler auch ein Ausgangspunkt für strukturelle Weiterentwicklung sein.
Erfahrungskultur: Eine Weiterentwicklung der Fehlerkultur
Doch gerade im Kontext von Innovation, Wandel und agilem Arbeiten greifen klassische Fehlerbegriffe oft nicht mehr: nur wenn klar ist, was „richtig“ wäre, kann eine Abweichung als „falsch“ gelten. Doch wie geht man mit Situationen um, in denen Regeln erst entstehen und neue Lösungen entwickelt werden?
Hier stößt Fehlerkultur an ihre Grenzen und macht den Weg frei für eine weiterentwickelte Perspektive: die Erfahrungskultur. Sie orientiert sich nicht an Abweichungen vom Soll, sondern erkennt an, dass Lernen integraler Bestandteil von Entwicklungsprozessen ist. In einer Erfahrungskultur geht es nicht um Schuld oder Abweichung, sondern um Erkenntnisgewinn. Sie schafft Räume für gemeinsames Ausprobieren, für Reflexion und für den konstruktiven Umgang mit Nichtwissen. Verwaltung und Staat sollen sich weiterentwickeln. Und wer sich verändern möchte, muss experimentieren. Dinge ausprobieren. Versuche wagen.
Bei vielen KI-Projekten ist dies derzeit zu beobachten. Wir erwarten oft Perfektion von Anfang an. Alles soll sofort funktionieren, fehlerfrei und vollständig sein. Doch KI-Projekte folgen einer anderen Logik:
- Sie sind iterativ
- Sie lernen und verbessern sich kontinuierlich
- Sie benötigen Zeit zur Entfaltung ihres vollen Potenzials
Projekte entfalten sich nicht „auf Ansage“, sie brauchen Zeit, Raum und Vertrauen. Was auf den ersten Blick als Fehler erscheint, kann sich bei näherem Hinsehen als wertvolle Erkenntnisquelle erweisen.
Gerade für eine Verwaltung, die sich auf den Weg zu mehr Agilität macht, ist dies ein entscheidender Perspektivwechsel. Denn wer neue Wege gehen will, muss Umwege, Rückschritte und auch das Scheitern als Teil des Prozesses zulassen, nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus Lernbereitschaft. Erfahrungskultur würdigt genau das: den Mut, sich auf Neues einzulassen, ohne sich für das Nicht-Gelingen rechtfertigen zu müssen. Natürlich ist im öffentlichen Sektor ein verantwortungsvoller Umgang mit Steuermitteln unverzichtbar. Doch wie viele Ressourcen tatsächlich nicht sinnvoll eingesetzt werden, weil sich niemand traut, neue Wege zu erproben, aus Angst vor möglichen Reaktionen auf ein mögliches Scheitern, wird sich kaum je beziffern lassen. Die Folge ist eine Kultur der Vorsicht.
Verzögerte und „gescheiterte“ Projekte und was wir daraus lernen können
Wird ein Projektziel verfehlt, darf der Blick nicht reflexhaft auf Einzelpersonen fallen. Weder Mitarbeitende noch Führungskräfte sollten persönlich haftbar gemacht werden, wenn ein Projekt nicht wie erhofft verläuft oder Wirkung erst verzögert eintritt. Gerade in Projekten wird deutlich, wie wichtig ein differenzierter Umgang mit dem Begriff Fehler ist. Denn Projekte sind per Definition einmalig, in Ziel, Kontext und Rahmenbedingungen. Es gibt keine festen, eindeutigen Maßstäbe, an denen sich ihr Verlauf interpretationsfrei messen ließe. Ohne stabile Referenzsysteme verliert auch der Fehlerbegriff an Schärfe. Vieles ist eher Erkenntnisgewinn, Lernschritt oder notwendige Korrektur als klarer Regelverstoß. Trotzdem wird bei gescheiterten Projekten häufig die Projektleitung als Hauptverantwortliche benannt, unabhängig davon, ob tatsächlich gegen geltende Vorgaben verstoßen wurde. Dabei wäre ein Fehler nur dann gegeben, wenn beispielsweise eindeutige gesetzliche Regelungen, wie etwa im Vergaberecht, missachtet wurden. In allen anderen Fällen handelt es sich nicht um Fehler, sondern um Irrtümer, um begründete Annahmen, die sich im Verlauf als unzutreffend erwiesen haben. Es ist genau dieser Prozess des Erfahrens, der Entwicklung möglich macht. Vergleichbar mit Thomas Edison, der nicht gescheitert ist, sondern viele Wege entdeckt hat, wie es nicht funktioniert, bevor die Glühbirne leuchtete.
Erfahrungskultur in Projekten heißt daher auch: Steuerung nicht durch Angst oder Abwesenheit von Angst vor Fehlern, sondern durch Mut zum Erkenntnisgewinn. Nur wer sich erlaubt, Irrtümer als Teil des Fortschritts zu begreifen, wird Projekte nicht nur abarbeiten, sondern wirklich gestalten.
Ein Beispiel für den Unterschied zwischen Fehler- und Erfahrungskultur stammt von Henry Ford. Ein leitender Ingenieur hatte durch eine Entscheidung einen hohen finanziellen Schaden verursacht. Als er in Fords Büro erschien, sagte er beschämt: „Ich übernehme die Verantwortung und kündige.“ Ford entgegnete: „Sind Sie wahnsinnig? Unsere Fehlschläge sind oft erfolgreicher als unsere Erfolge.“