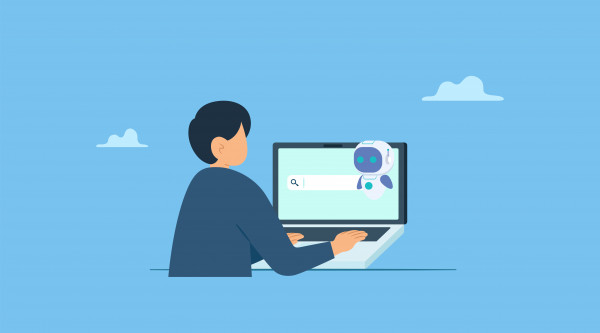Zwischen Parteibuch und Professionalität
Ergebnisse des Forschungsprojekts von Dr. Jana Marleen Walter
Wie viel politische Nähe verträgt eine professionelle Ministerialverwaltung und wie viel Distanz braucht sie, um ihre Legitimität zu wahren? Unter dem Titel „Zwischen Parteibuch und Professionalität – Neutralität, Netzwerk und Nähe“ habe ich am 24. Juni 2025 auf dem Panel „Erfolgsindikatoren und Kennzahlen für das gute HR-Management in der Verwaltung der Zukunft“ beim 11. Zukunftskongress Staat & Verwaltung Ergebnisse meines Forschungsprojekts vorstellen dürfen, das sich mit der Frage auseinandersetzt, wie politische Einflussfaktoren bei der Rekrutierung in Bundesministerien unterhalb der Führungsebene durch Mitarbeitende wahrgenommen werden. Die Ergebnisse der zugrundeliegenden Untersuchung bringen Implikationen für eine moderne, zukunftsfähige öffentliche Verwaltung mit sich. Dies gilt gleichermaßen für das Personalwesen als auch die Organisationskultur selbst.
Die für das Forschungsprojekt genutzten Daten basieren auf 30 qualitativen Interviews, die mit Beschäftigten des gehobenen und höheren Dienstes in sechs Bundesministerien in 2020 und 2021 geführt wurden. Im Mittelpunkt der Analyse steht die Wahrnehmung von Mitarbeitenden der Bundesministerialverwaltung gegenüber verschiedenen Rekrutierungswegen in die Organisation – zwischen Neutralität und politischer Loyalität.
In der Untersuchung wird dazu zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung unterschieden. Selbstwahrnehmung bezeichnet hierbei die Art und Weise, wie sich Verwaltungsmitarbeitende begreifen, ihre Karrierewege deuten und ihr professionelles Rollenverständnis artikulieren. Sie umfasst individuelle Einschätzungen zu Qualifikation, Legitimität und politischer Nähe und ist geprägt durch Selbstbeschreibungen, biografische Narrative und Werte. Fremdwahrnehmung hingegen bezieht sich auf die Sichtweise, die andere Personen auf Karriereschritte oder Verhaltensweisen einnehmen. Sie reflektiert Zuschreibungen, Einschätzungen und Bewertungen, die im sozialen Umfeld kursieren und von organisationalen Normen, kollektiven Erwartungshaltungen oder impliziten Loyalitätsvorstellungen beeinflusst sind.
Politisierungsformen im Rekrutierungskontext
In der verwaltungswissenschaftlichen Forschung haben sich bislang drei Politisierungsbegriffe im Rekrutierungskontext etabliert, die unterschiedliche Modi politischer Einflussnahme in der öffentlichen Verwaltung beschreiben: Formale Politisierung, Parteipolitisierung und Patronage.
Formale Politisierung bezeichnet gesetzlich legitimierte Verfahren, in denen politische Kriterien bei der Besetzung bestimmter Verwaltungspositionen zulässig sind. In Deutschland betrifft dies insbesondere die Spitzenämter der Ministerialverwaltung, etwa beamtete Staatssekretärinnen und Staatssekretäre sowie Abteilungsleitungen, deren Auswahl im Ermessen der jeweiligen politischen Führung liegt. Diese Form der Politisierung basiert auf institutionell kodifizierten Regeln und zielt darauf ab, politische Steuerungsfähigkeit auf oberster Ebene sicherzustellen, ohne das grundsätzliche Leistungsprinzip infrage zu stellen.
Parteipolitisierung geht über diese formal geregelte Ebene hinaus und beschreibt Praktiken, in denen Parteizugehörigkeit, parteipolitische Loyalität oder Nähe zu bestimmten politischen Lagern maßgeblich für Auswahl- und Aufstiegschancen im öffentlichen Dienst werden – auch außerhalb der legal politisierbaren Positionen. Sie steht dadurch im Spannungsverhältnis zur rechtlich verankerten Neutralitätsverpflichtung.
Patronage bezeichnet eine noch stärker personalisierte Form politischer Einflussnahme, bei der persönliche Loyalität, Netzwerktreue oder individuelle Nähe zu Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern über den Zugang zu administrativen Positionen entscheiden. Im Unterschied zur Parteipolitisierung ist Patronage nicht notwendigerweise an institutionelle Parteistrukturen gebunden, sondern operiert oft informell. Sie wird in liberal-demokratischen Systemen in der Regel als illegitime Einflussform verstanden, da sie das Leistungsprinzip und die institutionelle Integrität öffentlicher Verwaltung untergräbt.
Drei empirische Rekrutierungstypen
Das vorliegende Forschungsprojekt fokussiert nun erstmals auf rekrutierungsbasierte Politisierungsformen unterhalb der formal politisierbaren Ebene. Auf dieser konzeptionellen Grundlage lassen sich wiederum empirisch drei Typen identifizieren: Nicht-Politisierung, bei der der Zugang über klassische Verfahren ohne politischen Einfluss erfolgt, parteibezogene Rekrutierung, bei der politische Nähe (etwa durch frühere Tätigkeiten für Parteien oder Abgeordnete) eine übergeordnete Rolle spielt und professionelle Politisierung als völlig neu etabliertes Konzept, wobei politische Erfahrungen die fachliche Eignung nicht ersetzen, sondern ergänzen.
Karrieren im Spiegel von Selbst- und Fremdwahrnehmung
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Politisierung in der öffentlichen Verwaltung auch unterhalb der Spitzenpositionen nicht grundsätzlich eine Anomalie darstellen muss. Entscheidend ist, wie diesem Phänomen in all seinen Facetten institutionell, kulturell und diskursiv begegnet wird.
Insgesamt zeigt die Analyse eine ausgeprägte Asymmetrie zwischen den beiden Wahrnehmungsebenen der Selbst- und Fremdwahrnehmung: Nahezu alle befragten Verwaltungsmitarbeitenden deuten ihre eigene Karriere retrospektiv als fachlich fundiert, regelkonform und unabhängig von parteipolitischer Einflussnahme. Politische Stationen – etwa frühere Tätigkeiten in Abgeordnetenbüros oder Parteigliederungen – werden entweder neutralisiert oder funktional umgedeutet. Diese Selbstdeutungen dienen der Wahrung eines professionellen Selbstbildes, das stark durch die Norm der politischen Neutralität geprägt ist. Politische Anschlussfähigkeit wird dabei eher als implizite Anforderung anerkannt denn als identitätsstiftendes Merkmal offen benannt.
Demgegenüber sind Fremdzuschreibungen deutlich kritischer. Mitarbeitende ordnen politisch geprägte Werdegänge nicht selten dem Deutungsmuster „Parteinähe“ zu – mitunter verbunden mit einem impliziten Vorwurf mangelnder Objektivität oder ungerechtfertigter Privilegierung im Auswahlprozess. Besonders betroffen sind Personen, deren Zugänge über politische Referentinnen- und Referentenstellen oder Kabinettsbüros verliefen. Obwohl diese regelmäßig in ihrer Selbstbeschreibung ein hohes Maß an fachlicher Integrität glaubhaft machen können (z.B. durch exzellente Qualifikationen und fachliche Abschlüsse), dominieren im organisationalen Umfeld Misstrauenssignale. So wird politische Erfahrung grundsätzlich nicht als Zusatzqualifikation, sondern als Risikofaktor wahrgenommen.
Spannungsfeld zwischen Professionalität und politischer Prägung
Diese Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung ist mehr als ein kommunikativer Nebeneffekt, denn sie offenbart eine tieferliegende Diskrepanz im professionellen Habitus der Verwaltung. Auf individueller Ebene verdeutlicht sie das Bedürfnis, politische Erfahrungen strategisch zu entkontextualisieren, um mit dem meritokratischen Idealbild kompatibel zu bleiben. Auf kollektiver Ebene verweist sie auf eine kulturelle Unsicherheit gegenüber politischen Karrieren in der Verwaltung, insbesondere dort, wo formale Transparenz fehlt oder institutionelle Kriterien uneindeutig sind. Dies wird durch wiederkehrende Narrative unterstützt, denn während Begriffe wie „politisch“ oder „Partei“ häufig fallen, wird das Wort „Politisierung“ annähernd vollständig gemieden. Die damit verbundenen negativen Konnotationen widersprechen dem Selbstbild der unvoreingenommenen Fachlichkeit. Dies überrascht insbesondere vor dem Hintergrund, dass gleichzeitig innerhalb der Interviews deutlich gemacht wird, dass politische Sensibilität im ministeriellen Alltag unverzichtbar ist – etwa, um Themen strategisch zu platzieren oder Führungserwartungen zu antizipieren. Gerade die Gruppe der professionell politisierten Akteurinnen und Akteure verkörpert eine hybride Rolle. Sie sind fachlich versiert, zugleich politisch anschlussfähig und oft besonders wirksam an der Schnittstelle von Politik und Verwaltung. Doch auch sie begegnen intern dem Misstrauen ihrer Kolleginnen und Kollegen.
Governance-Learnings für die Verwaltung der Zukunft
Für die Governance moderner Ministerialbürokratien ergeben sich daraus folgende Learnings: Erstens, dass es mehr Transparenz über Karrierewege und ihre Prägung durch politische Erfahrungen braucht und zweitens, dass politische Sensibilität als Kompetenz anerkannt, aber nicht grundsätzlich als Qualifikationsersatz gewertet werden sollte. Nicht zuletzt gilt es, die Unterscheidung zwischen parteibezogener Rekrutierung und professioneller Politisierung klarer zu treffen. Während professionelle Politisierung die Leistungsfähigkeit von Verwaltung stärken kann, stellt parteibezogene Rekrutierung eine ernsthafte Herausforderung für Legitimität und Vertrauen dar. Beide Phänomene mögen sich ähneln, doch sie unterscheiden sich in ihrer Motivation und Wirkung.
📥 Kostenloser Download für VdZ|Plus-Leser*innen
Leser*innen mit einem VdZ|Plus-Konto können sich im anschließenden Bereich die Präsentation von Dr. Walter als PDF runterladen.
➡️ Interessierte ohne Konto können sich einfach kostenlos über diesen Link für VdZ|Plus registrieren.
VdZ|Plus-Leser*innen haben Zugriff auf vertiefende Materialien rund um die Digitalisierung des öffentlichen Sektors: Studien, Whitepapers, Tagungsunterlagen und exklusives Videomaterial
Exklusiver Inhalt für unsere VDZ-Plus-Leser
Loggen Sie sich hier ein oder
Registrieren Sie sich als VDZ-Plus-Leser.