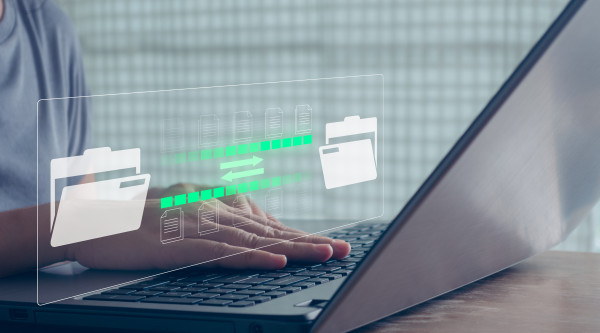„Digitalisierung braucht Mut und klare Zuständigkeiten“
Christina Ramb über das neue Digitalministerium und Bürokratieabbau
Verwaltung der Zukunft: In Ihrem Positionspapier fordern Sie ein Digitalministerium und strukturelle Veränderungen. Was sind die zentralen Aussagen des Papiers und wie schätzen Sie die aktuellen Entwicklungen des Digitalministeriums ein?
Christina Ramb: Wir finden es richtig, dass wir jetzt ein Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung haben. Wir haben es in der Vergangenheit mit verschiedenen anderen administrativen Strukturen versucht. Richtig gefruchtet hat das nicht. Für uns war insbesondere wichtig, dass es klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten innerhalb der Bundesregierung gibt. Zu oft haben die verschiedenen Bundesministerien unabgestimmt und aneinander vorbei Digitalisierungsprojekte vorangetrieben. Synergien wurden nicht gehoben, Doppelstrukturen geschaffen. Damit ist jetzt hoffentlich Schluss. Das neue Ministerium hat einen echten Zustimmungsvorbehalt für alle wesentlichen IT-Ausgaben der unmittelbaren Bundesverwaltung. Es wird zudem mit einem eigenen Budget ausgestattet sein. Beides sind Voraussetzungen, um mehr Tempo in die Digitalisierung von Verwaltung, Wirtschaft und Arbeitswelt zu bekommen
VdZ: Sie sprechen vom „politischen Willen“ als entscheidende Voraussetzung. Ist dieser Wille in der Politik durch die Einrichtung des Digitalministeriums für Sie bereits ausreichend?
Ramb: Ja, ich sehe den politischen Willen. Neue Ministerien werden nicht jede Legislatur gegründet. Insofern war das schon eine mutige und konsequente Entscheidung. Wie ein CIO oder CDO in Unternehmen auch, braucht jetzt auch der Bundesminister für Digitales das volle Backing der Spitzen der Koalition – also von Kanzler, Vizekanzler und Parteivorsitzenden. Ohne diese Rückendeckung werden die tiefgreifenden Veränderungen nicht durchgesetzt werden können. Wenn das Ministerium den Zustimmungsvorbehalt anmeldet, muss es das auch durchsetzen können. Momentan sehe ich diesen politischen Rückhalt. Das sind gute Voraussetzungen für den Erfolg.
VdZ: Sie sprechen auch von einem „neuen Mindset“ in der Verwaltung. Was verstehen Sie darunter konkret und wie kann ein solcher Kulturwandel in einer traditionell als schwerfällig geltenden Verwaltungsstruktur gelingen?
Ramb: Ein zukunftsfähiger Staat muss modern und agil sein, dazu gehört auch, dass sich der öffentliche Dienst wandelt. Ohne mehr Bereitschaft zu Veränderungsprozessen, dem Willen, Neues auszuprobieren, und einer offenen Fehlerkultur bleibt echter Fortschritt aus. Das neue Bundesdigitalministerium setzt sich aus Abteilungen des Bundeskanzleramts sowie fünf Ministerien zusammen – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen dabei unterschiedliche Verwaltungskulturen aus ihren Herkunftsbehörden mit. Dazu kommt ein Minister an der Spitze, der aus der Wirtschaft kommt. Diese neuartige, teils disruptive Konstellation bietet eine echte Chance, die genutzt werden muss. Das Ministerium kann zu einem Labor für moderne Behördenarbeit werden – ein Ort des Ausprobierens, Lernens und der Innovation. Und: Es kann als Vorbild für alle anderen Verwaltungen fungieren. Das Ministerium sollte mit Blick auf neue Technologien und neue Prozesse in der Verwaltung eine Art „Costumer Zero“ werden.
VdZ: Sie kritisieren, dass der Staat zunehmend in die Rolle der wirtschaftlichen Steuerung hineinwächst. In welchen Bereichen sollte sich der Staat aus Ihrer Sicht stärker zurücknehmen?
Ramb: Zu viel Bürokratie und Regulierung hemmen die wirtschaftliche Entwicklung und führen zugleich dazu, dass der Staat – insbesondere mit Blick auf den demografischen Wandel – zunehmend Schwierigkeiten hat, seine Kernaufgaben zu erfüllen. Weniger Bürokratie, etwa durch den Abbau übermäßiger Berichtspflichten für Unternehmen, entlastet nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die öffentliche Verwaltung. Aber auch Informations- und Dokumentationspflichten binden in erheblichem Umfang personelle und finanzielle Ressourcen, die zur Erfüllung des Kerngeschäfts fehlen. Wichtige Vorhaben dürfen nicht durch langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren ausgebremst werden. Dabei ist zu beobachten, dass sich der Staat immer stärker in der Rolle gefällt, wirtschaftliche Prozesse im Detail zu steuern. Er greift in einer Tiefe in unternehmerische Abläufe ein, die weder notwendig noch zielführend ist. Gerade diese Überregulierung erzeugt Komplexität – und Komplexität ist der Nährboden für Bürokratie. Statt jedes denkbare Einzelszenario regeln zu wollen, sollte sich der Staat auf klare Rahmenbedingungen und seine eigentlichen Kernaufgaben konzentrieren. Es braucht mehr Fokus, weniger Mikromanagement.
Wir brauchen daher eine ehrliche und systematische Aufgabenkritik. Der Staat muss sich
stärker auf das Wesentliche beschränken – auch aus eigenem Interesse, um handlungs- und
leistungsfähig zu bleiben.
VdZ: Wie sieht für Sie ein zukunftsfestes Staatsverständnis aus?
Ramb: Der Staat sollte seinen Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen mehr vertrauen und ihnen auch mehr zutrauen – und nicht den Anspruch erheben, jeden Einzelfall bis ins letzte Detail regeln zu müssen. Er sollte sich als Ermöglicher, nicht als allgegenwärtiger Kontrolleur verstehen.
Statt immer neue Vorgaben und Regulierungen zu schaffen – die auch die Verwaltung überfordern –, braucht es klare, verlässliche Rahmenbedingungen mit möglichst viel Raum für Eigenverantwortung, Innovation und unternehmerisches Handeln. Der Staat sollte sich auf seine zentralen Aufgaben konzentrieren – innere und äußere Sicherheit, Bildung, Infrastruktur, eine effiziente und handlungsfähige Verwaltung – auch im Sozialen – und Justiz – und dabei effizient, digital und bürgernah agieren.
VdZ: Wie müsste Ihrer Meinung nach ein realistischer, politisch konsensfähiger Digitalpakt zwischen Bund, Ländern und Kommunen aussehen?
Ramb: Die im vergangenen Jahr veröffentlichte gemeinsame Erklärung von Bund und Ländern zum Digitalpakt 2.0 bildet eine gute Grundlage für die Fortsetzung des Digitalpakts Schule. Jetzt kommt es darauf an, dass die notwendigen Bund-Länder-Vereinbarungen schnellstmöglich abgeschlossen werden und die notwendigen Mittel bereitgestellt werden, damit die Umsetzung starten kann. Die drei geplanten Handlungsstränge „leistungsstarke
Bildungsinfrastruktur“, „digitalisierungsbezogene Schul- und Unterrichtsentwicklung“ sowie digitales Lehren und Lernen“ adressieren die zentralen Herausforderungen in den Schulen.
Es ist z. B. nicht akzeptabel, dass es immer noch viele Schulen gibt, die digitale Möglichkeiten nicht nutzen können, weil sie kein ausreichendes WLAN-Netzwerk haben. Genauso wenig ist nachvollziehbar, dass man immer noch ein Lehramtsstudium absolvieren kann, ohne mit dem Thema „digitales Lehren und Lernen“ in Berührung gekommen zu sein. Ohne eine entsprechend Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte und ohne Konzepte und Medien für das digitale Unterrichten kann Digitalisierung ihre Wirkung an den Schulen nicht entfalten.
📅 Christina Ramb auf dem 4. ZuKo Sozialversicherungen
26. November 08:30 - 09:30: Eröffnungsplenum I.I
Sozialstaat der (nahen) Zukunft – digital, kundenorientiert, aktivierend und gerecht?