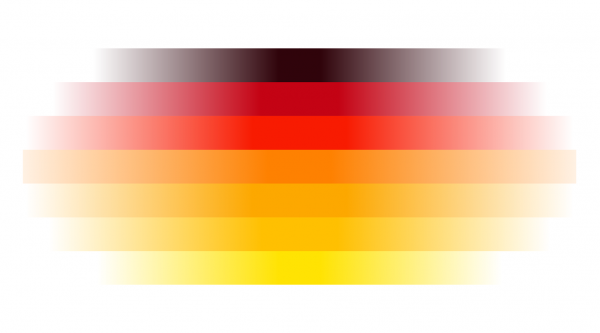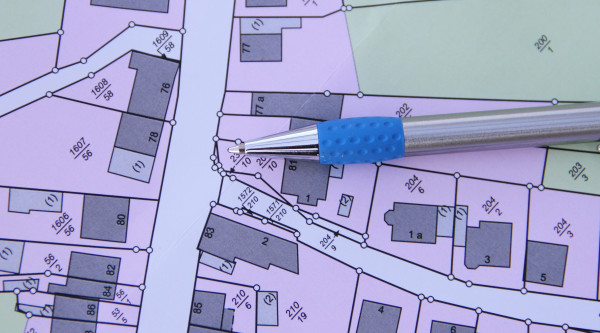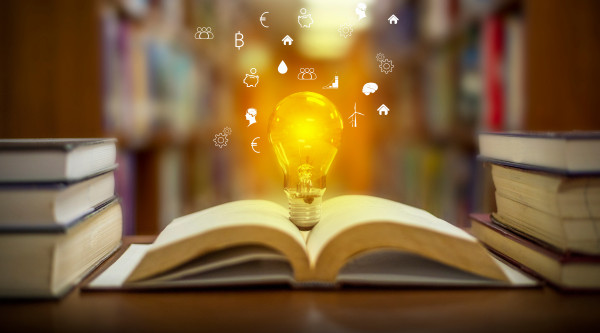Verwaltung der Zukunft: Sie sind mit 35 Jahren eine der jüngsten CIOs in Deutschland und kommen direkt aus der Wirtschaft. Was hat Sie an der Aufgabe besonders gereizt und welche Erfahrungen aus Ihrer Zeit als Gründerin und CEO möchten Sie nun in die Verwaltung übertragen?
Milen Starke: Ich war schon in meinem früheren Unternehmen, das seit über 35 Jahren in der Kommunalwirtschaft tätig ist, eng mit Themen der Verwaltungsdigitalisierung verbunden. Dennoch war mein Wirkungskreis dort begrenzt. In den Projekten habe ich gesehen, wo man an Stellschrauben drehen könnte. Das hat mich gereizt, meinen Einflussbereich zu erweitern und mich für Thüringen einzubringen. Es ist für mich eine große Ehre, in so jungen Jahren diese Aufgabe übernehmen zu dürfen. Aus meiner Zeit als Gründerin und CEO bringe ich vor allem Erfahrungen in der Transformation, in der Führung und aus fast zehn Jahren Arbeit in der Verwaltungsdigitalisierung mit. Das sind alles Qualitäten, die für die CIO-Rolle in Thüringen sehr relevant sind.
VdZ: Wo konnten Sie Ansätze aus der Unternehmensführung schon erfolgreich nutzen?
Starke: Ich bin jetzt seit rund vier Monaten im Amt, daher stand zunächst die Einarbeitung im Vordergrund. Dennoch konnte ich bereits einige unternehmerische Ansätze einbringen, etwa Eigenverantwortung, pragmatisches Handeln und eine gesunde Fehlerkultur. In der Verwaltung ist es mir wichtig, diese Haltung zu fördern: nicht alles umwerfen, aber gezielt umdenken, über den Tellerrand schauen und lösungsorientiert arbeiten. Wir sprechen hier von einer „Ermöglichungskultur“, also dem Anspruch, Herausforderungen pragmatisch anzugehen. Gerade mit Blick auf die politische Lage in Thüringen ist es entscheidend, dass wir Fortschritte machen und uns nicht im Kreis drehen. Diese unternehmerische Denkweise teile ich auch mit unserem Minister Steffen Schütz. Das hilft uns, die Digitalisierung im Land konkret voranzubringen.
VdZ: Thüringen ist vergleichsweise klein. Welche besonderen Chancen bringt das für die digitale Verwaltung?
Starke: Ich würde Thüringen als überschaubar bezeichnen. Das ist ein Vorteil, weil wir die relevanten Akteure gut kennen, von den kommunalen Spitzenverbänden bis zur IT-Wirtschaft. Der Austausch funktioniert auf Augenhöhe, und wir können Entscheidungen schneller umsetzen. Durch die kleineren Strukturen haben wir zudem die Möglichkeit, neue Ansätze unkomplizierter zu erproben und Pilotprojekte mit geringeren Hürden zu starten.
VdZ: Die Diskussion um den „Deutschland-Stack“ nimmt Fahrt auf. Welche Chancen und Grenzen sehen Sie für Thüringen? Und wie stehen Sie zur These, dass Standardisierung Nischenanbieter verdrängen könnte?
Starke: Ich halte den Deutschland-Stack für zwingend notwendig. Standardisierung ist für mich keine Bedrohung, sondern die Basis für digitale Souveränität. Auch wir in Thüringen haben mit dem „Thüringen-Stack“ ein ähnliches Konzept entwickelt. Seit wir hier erstmals ein eigenes Digitalministerium haben, können wir Digitalisierung zentral betrachten – ähnlich wie der Bund. Dabei geht es uns um klare Strukturen, Governance, Konsolidierung und vor allem die Einbindung von Kommunen und Gesellschaft.
Die starke Heterogenität unserer IT-Landschaft führt oft zu ineffizienten Prozessen. Etwa, wenn Bürger Online-Anträge noch ausdrucken und unterschreiben müssen. Solche Abläufe sind weder erklärbar noch zeitgemäß. Standards helfen, das zu ändern. Ich sehe darin auch keine Gefahr für Nischenanbieter, im Gegenteil: Viele fordern selbst einheitliche Schnittstellen, damit sie nicht für jedes Bundesland eigene Lösungen entwickeln müssen. Deshalb begrüße ich den Deutschland-Stack ausdrücklich und wünsche mir, dass wir mit unseren Erfahrungen aus dem Thüringen-Stack aktiv zur Weiterentwicklung beitragen können.
Standardisierung ist für mich keine Bedrohung, sondern die Basis für digitale Souveränität.
VdZ: Gibt es Themenfelder, in denen Thüringen bewusst eigene Nischen besetzen will?
Starke: Wir wollen vor allem im Bereich digitale Souveränität vorangehen. Wir arbeiten stark mit Open-Source-Technologie und haben eine Thüringer Verwaltungscloud aufgebaut, die komplett auf Open-Source-Komponenten basiert. Damit sind wir unabhängig von externen Rechenzentren und großen internationalen Konzernen.
Ein weiteres Schwerpunktfeld ist „Law as Code“: Wir machen Rechtsvorschriften maschinell auswertbar, damit Verwaltungsprozesse automatisierbar werden und KI-Lösungen eingesetzt werden können. Hier arbeiten wir eng mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena zusammen und haben bereits eine Basis geschaffen, die uns zum Govtech-Campus gemacht hat.
Darüber hinaus beschäftigen wir uns gezielt mit KI, insbesondere in der E-Akte, um Lösungen zu entwickeln, die auch für andere Bundesländer nutzbar sind. Thüringen hat damit Projekte, die bundesweit Strahlkraft haben und das Land als digitalen Vorreiter positionieren.
VdZ: Woran liegt es, dass Thüringen bei der digitalen Souveränität so weit ist?
Starke: US-amerikanische Hersteller sind weit verbreitet, weil ihre Produkte oft breiter funktional aufgestellt sind als Open-Source-Komponenten. Ein Umbau der eigenen Infrastruktur auf Open Source ist umständlich, aber wir haben schon vor fast 20 Jahren mit dem Aufbau eines eigenen Rechenzentrums den Grundstein für eine souveräne, autarke Infrastruktur gelegt. Seitdem setzen wir zunehmend auf Open Source, eine Philosophie, die wir seit zwei Jahrzehnten verfolgen. Andere Bundesländer haben damals andere Wege gewählt, was damals sinnvoll war. Wesentlich verändert hat sich vor allem der US Cloud Act, der US-Unternehmen Zugriff auf Cloud-Daten gewährt, das hat das Denken über Souveränität stark beeinflusst. Thüringen war hier schon einige Schritte voraus.
VdZ: Welche digitalen Projekte haben in den nächsten zwei bis drei Jahren die höchste Priorität? Und wie stellen Sie sicher, dass diese Projekte nachhaltig wirken – also nicht nur starten, sondern langfristig tragen?
Starke: Ich beginne vielleicht mit der zweiten Frage, weil sie für mich die Grundlage bildet: Was müssen wir tun, damit Digitalisierung überhaupt funktioniert? Da komme ich immer wieder auf das Thema Struktur und Governance zurück. Es muss klar sein, wer wofür verantwortlich ist, wie die Kommunikationswege verlaufen. Was machen wir als Ministerium, wofür sind andere Ressorts zuständig, wie ist der Haushalt aufgestellt, welche Gremien – etwa mit den kommunalen Spitzenverbänden oder der Arbeitsebene in den Kommunen – greifen ineinander?
Dazu gehört auch, unsere Digitalagentur und die kommunalen IT-Dienstleister zu stärken, damit alles in einer stringenten Gesamtstruktur zusammenläuft. Wir haben dafür die Grundlage gelegt: unsere Smart-State-Strategie, die wir in den nächsten ein bis zwei Jahren in die Umsetzung bringen. Denn ohne Struktur und klare Zuständigkeiten nützen uns die besten Technologien nichts; sie müssen dort ankommen, wo sie gebraucht werden.
Das zweite große Thema ist der Thüringen-Stack, bestehend aus Infrastruktur, Daten, Anwendungen und Prozessen. Wir arbeiten zudem an einer Art „Thüringer X-Road“, auf die verschiedene Anwendungen und Formulare aufsetzen können. Dabei konzentrieren wir uns auf drei Kernbereiche: Identifikation, Transaktion und Datenaustausch. Wenn diese Prozesse sauber definiert sind, spielt es kaum eine Rolle, welches Fachverfahren dahinterliegt.
Darauf aufbauend treiben wir die Registermodernisierung voran, mit dem Ziel, dass es künftig einen zentralen Datensatz pro Bürger*in gibt, der über diese drei Mechanismen sicher zwischen Systemen übermittelt wird. Das ist ein anspruchsvolles Vorhaben, an dem auch der Bund arbeitet. Aber wir in Thüringen warten nicht ab, wir gehen gezielt voran, natürlich im Austausch mit dem Bund.
Am Ende muss es unser Anspruch sein, dass Bürger*innen nicht mehr verstehen müssen, warum Dokumente noch ausgedruckt und vor Ort unterschrieben werden müssen. Neben Themen wie Cybersicherheit, IT-Weiterbildung und Digitalstrategie liegt unser Hauptaugenmerk daher ganz klar auf einer stabilen, nachhaltigen Struktur.
VdZ: Wo sehen Sie Thüringen im Jahr 2030 digital?
Starke: Unser Ziel ist es, vom klassischen Antragsdenken wegzukommen und Verwaltung als Informationsquelle zu begreifen. Ein Beispiel ist der Personalausweis: Die Behörde weiß genau, wann er abläuft. Statt dass Bürger*innen aktiv einen Antrag stellen, könnte die Verwaltung automatisch informieren: „Ihr Ausweis läuft ab, möchten Sie einen neuen beantragen?“ Mit einem Klick, einer Unterschrift und der Zahlung wäre alles erledigt. Dieses Prinzip – weg vom Antrag, hin zur intelligenten Informationssteuerung – ist für uns die Grundlage, um Verwaltungsdigitalisierung wirklich in die Gesellschaft zu bringen.
Ein zweiter, ganz zentraler Punkt ist die Akzeptanz. Studien zeigen, dass in Thüringen die Skepsis gegenüber Digitalisierung vergleichsweise hoch ist, gerade bei jüngeren Menschen und bei Frauen. Etwa jede vierte Thüringerin und jeder vierte Thüringer fühlt sich nicht sicher im Umgang mit digitalen Angeboten. Deshalb setzen wir auf zwei Schwerpunkte: Befähigung und Beteiligung.
Bei der Befähigung geht es um Bildung, in Schulen, Hochschulen und der Erwachsenenbildung. Wir wollen Medienkompetenz systematisch stärken. Ein Beispiel ist unsere Initiative FSJ Digital: Junge Menschen können ein freiwilliges digitales Jahr absolvieren, werden in Digitalthemen geschult und unterstützen dann z. B. Altenheime oder kleine Unternehmen bei der Digitalisierung.
Der zweite Schwerpunkt ist Beteiligung. Wir gehen bewusst in die Kommunen, in den ländlichen Raum, wo oft ein gewisses Misstrauen gegenüber Veränderung herrscht – historisch gewachsen und nachvollziehbar. Uns ist wichtig, dort im direkten Austausch zu erklären, dass Digitalisierung nichts Bedrohliches ist, sondern Chancen schafft: für Standort, Wirtschaftskraft und letztlich auch für Wohlstand.
Wenn wir es bis 2030 schaffen, dass die Menschen Digitalisierung als etwas Positives, Nützliches und Vertrauenswürdiges erleben, dann haben wir eines unserer größten Ziele erreicht.
Digitalisierung schafft Chancen für Standort, Wirtschaftskraft und letztlich auch für Wohlstand.
VdZ: Haben Sie noch weitere abschließende Worte?
Starke: Ein wichtiger Punkt ist für mich, die Verwaltungsmitarbeitenden zu würdigen. Oft hat man das alte Stereotyp von verstaubten 9-to-5-Strukturen im Kopf. Hier in Thüringen sehe ich das überhaupt nicht. Stattdessen arbeitet das Team super engagiert: Jede*r kennt seine Rolle, weiß, wovon die Arbeit anderer abhängt und bringt eigene Ideen ein. Die Verwaltung denkt wirklich die „nächste Meile“ mit und es herrscht ein gutes Miteinander, das hat mich positiv überrascht.