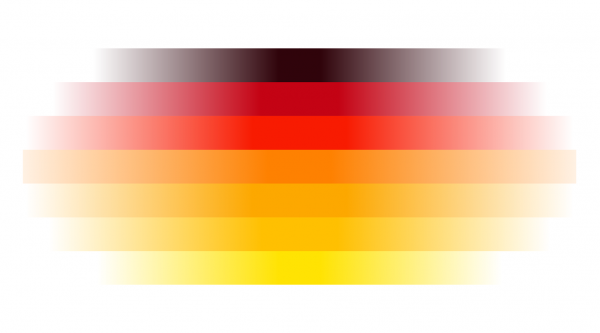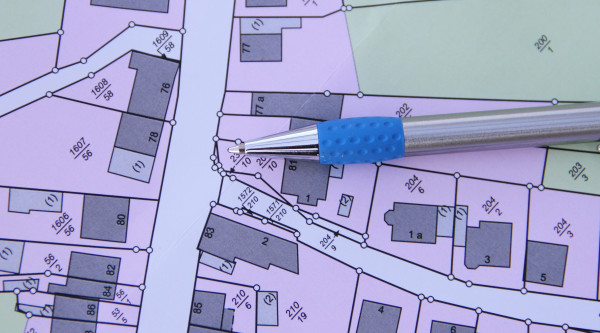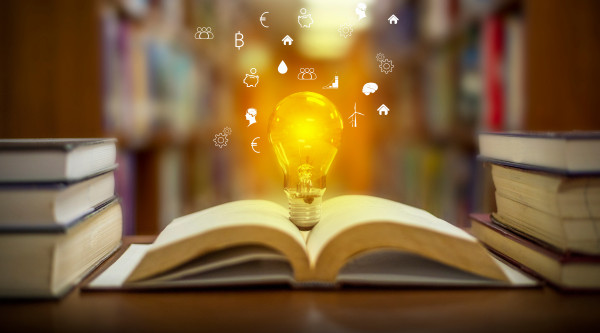Mobilfunkstandards als Rückgrat der Digitalisierung
Die Entwicklung der Mobilfunkstandards von 2G (GSM) über 3G (UMTS) und 4G bis hin zu 5G hat die Digitalisierung moderner Gesellschaften maßgeblich geprägt. Während die ersten Generationen vor allem die Sprach- und Textkommunikation sowie einfache mobile Internetanwendungen ermöglichten, steht mit 5G ein technischer Quantensprung im Raum: Die Plattformen und Dienste, die heute genutzt werden, sind wesentlich datenintensiver und vielfältiger – Streaming, On-Demand-Services, Mobilitäts-Apps und cloudbasierte Anwendungen sind inzwischen fixer Bestandteil des Alltags vieler Menschen. Gerade diese Transformation wurde durch eine kontinuierlich steigende Netzabdeckung und verfügbare Bandbreiten erst möglich.
Allerdings bestehen, insbesondere in Deutschland, weiterhin große Herausforderungen bei der Netzabdeckung. „Weiße Flecken“, also Regionen ohne ausreichende Breitband- oder Mobilfunkversorgung, schränken sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen erheblich ein. Im europäischen Vergleich hinkt Deutschland zum Teil deutlich hinterher, besonders im ländlichen Raum. Hier zeigt sich, wie wichtig eine flächendeckende, leistungsfähige Infrastruktur für wirtschaftliche Entwicklung, Lebensqualität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist – Aspekte, die häufig unterschätzt werden, aber direkte Auswirkungen auf Innovationsfähigkeit, Digitalisierungsfortschritt und Wettbewerbsfähigkeit haben.
Mit der Einführung von 5G wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht: Die Technologie bietet deutlich niedrigere Latenzen, hohe Übertragungsraten und eine verbesserte Zuverlässigkeit. Das ist nicht nur für Privatnutzer relevant, sondern vor allem auch für smarte Städte und die digitale Verwaltung. 5G gilt als Katalysator für datengetriebene Innovationen in Bereichen wie öffentlichem Verkehr, Telemedizin, Bildung und urbaner Sicherheit. Plattformlösungen ermöglichen es Verwaltungen etwa, Bürgerdienste zu digitalisieren oder eine bessere Vernetzung zwischen verschiedenen Akteuren zu etablieren.
Die Erwartungen an 6G als Baustein der nächsten Digitalisierungsstufe
Ein zentrales Thema im aktuellen Diskurs ist jedoch bereits der nächste Mobilfunkstandard: 6G. Die Erwartungen an 6G sind hoch, denn die Grenze der Leistungsfähigkeit von 5G (aktuell bei etwa 3.600 MHz) dürfte angesichts der rasant steigenden Anforderungen schnell erreicht sein. Insbesondere Anwendungen rund um Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und hochaufgelöste Echtzeit-Dienste benötigen noch höhere Bandbreiten und extrem geringe Latenzzeiten. Laut aktuellen Studien besitzt bereits heute etwa jeder dritte Bundesbürger eine VR-/AR-Brille oder plant deren Nutzung – ein deutlicher Indikator für die wachsende Bedeutung immersiver Technologien auch im Massenmarkt.
Der Trend zur umfassenden Digitalisierung macht vor der öffentlichen Verwaltung nicht Halt. Zukünftig werden datengetriebene und interaktive Verwaltungsleistungen zur Norm werden – beispielsweise digitale Bürgerservices, Online-Partizipationsplattformen oder vernetzte, adaptive städtische Infrastrukturen. All diese Angebote setzen eine hochverfügbare und sichere Netzkonnektivität voraus. Die Expertinnen und Experten sehen in 6G deshalb eine essentielle Weiterentwicklung, die nicht nur industrielle Anwendungsfälle (wie Fabrikautomatisierung oder autonomes Fahren) adressiert, sondern ebenso den Alltag der Bevölkerung nachhaltig prägen wird.
6G soll, so die Erwartung, einen signifikanten Mehrwert bieten: Es ermöglicht massiv gesteigerte Übertragungskapazitäten und extrem niedrige Latenzen, die immersive, interaktive und nahezu „surreale“ Nutzererlebnisse Realität werden lassen. Gesundheitswesen, Bildung, Verwaltung und Unterhaltung profitieren somit gleichermaßen. Diese technologischen Möglichkeiten eröffnen nicht nur neue Geschäftsfelder, sondern verändern auch das Verhältnis der Akteure in Wirtschaft, Gesellschaft und Staat: Smart Cities werden zu Innovationsräumen, in denen Bürger, Verwaltung und Unternehmen eng zusammenarbeiten und voneinander profitieren können.
Abschließend zeigt sich: Die Zukunft der digitalen Gesellschaft ist untrennbar mit dem Fortschritt im Mobilfunkbereich verbunden. Nur wenn Deutschland – insbesondere in Sachen Netzabdeckung und Infrastruktur – eine Vorreiterrolle übernimmt, kann es die internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern und die Herausforderungen der kommenden Jahre erfolgreich meistern. 6G wird dabei als ein entscheidender Baustein für die nächste Stufe der Digitalisierung und als Treiber neuer, intelligenter Services gesehen – nicht als optionales Upgrade, sondern als notwendige Voraussetzung für die digitale Transformation von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft.
Im Bereich des öffentlichen Raums ermöglichen die hohen Bandbreiten und niedrigen Latenzen von 5G und zukünftig 6G eine Vielzahl smarter Dienste:
- Digitale Bürgerdienste: Termine, Anträge und Verwaltungsvorgänge können ortsunabhängig, benutzerfreundlich und in Echtzeit über mobile Endgeräte abgewickelt werden. Plattformbasierte Systeme erlauben es beispielsweise, Dokumente live zu signieren, Anfragen zu verfolgen oder digitale Identitäten sicher zu verwalten.
- Positionsbasierte Services: Im öffentlichen Raum entstehen standortbezogene Dienste wie intelligente Wegweiser, barrierefreie Navigation für Menschen mit Einschränkungen und tagesaktuelle Informationen zu Verkehr, Umwelt oder Veranstaltungen.
- Smarte Mobilität: Vernetzte Verkehrsangebote – etwa intelligente Ampelsysteme, dynamische Fahrgastinformationen oder On-Demand-Shuttles – werden über schnelle Mobilfunknetze orchestriert und verbessern nachhaltig die Erreichbarkeit und Flexibilität im urbanen Verkehr.
- Öffentliche Sicherheit und Gesundheit: Videoüberwachung, intelligente Notrufsysteme und vernetzte Rettungsdienste profitieren von lückenloser Übertragung großer Datenmengen in Echtzeit. Gesundheits- und Umweltdaten (z.B. Luftqualitätssensoren) werden direkt in öffentliche Warn- und Informationssysteme eingespeist.
- Multimediale Informationsangebote: Große öffentliche Displays, interaktive Stadtführer oder AR-Anwendungen machen Städte erlebbarer. Bürger und Touristen können durch Virtual und Augmented Reality interaktiv städtische Sehenswürdigkeiten, Kunstobjekte oder historische Ereignisse erleben.
- Partizipation und Bürgerbeteiligung: Über sichere, mobile Plattformen können Abstimmungen, Umfragen oder Mitmach-Projekte im öffentlichen Raum unkompliziert organisiert werden. Bürger erhalten die Möglichkeit, Anregungen direkt vor Ort digital einzureichen oder kommunale Entscheidungsprozesse aktiv mitzugestalten.
Die Voraussetzung für diese Dienste ist eine zuverlässig leistungsfähige, flächendeckende Netzabdeckung als „digitale Daseinsvorsorge“. Nur so lassen sich Plattform- und Datenökonomien auch im öffentlichen Sektor voll entfalten und innovative Smart City-Anwendungen für alle zugänglich machen. 6G wird die Bandbreiten bereitstellen, die für immersive Anwendungen wie städtische AR-Erlebnisse, vernetzte Stadtmöblierung oder KI-unterstützte Bürgerassistenzsysteme erforderlich sind.
Langfristig führt diese Entwicklung dazu, dass Städte und Gemeinden weit mehr als nur Verwaltungsdienstleistungen digitalisieren: Der öffentliche Raum transformiert sich zur interaktiven, intelligenten und partizipativen Umgebung, in der Bürgerinnen und Bürger von einer neuen Dimension an Dienstleistungsqualität profitieren. Die Schaffung, Pflege und Weiterentwicklung dieser digitalen Angebote wird damit zu einer Kernaufgabe kommunaler Daseinsvorsorge und stärkt zugleich die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Städte.