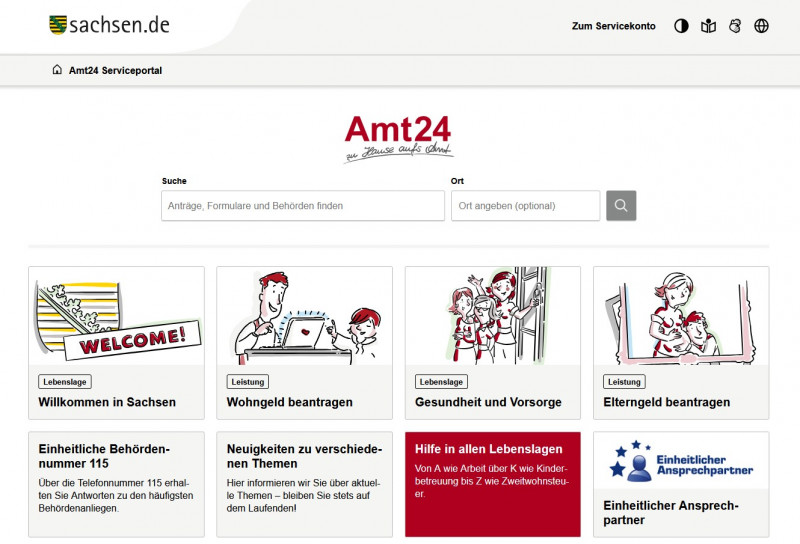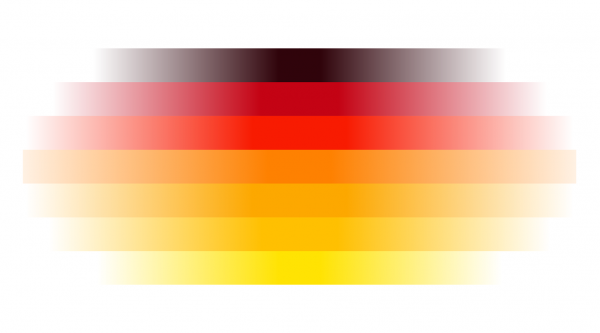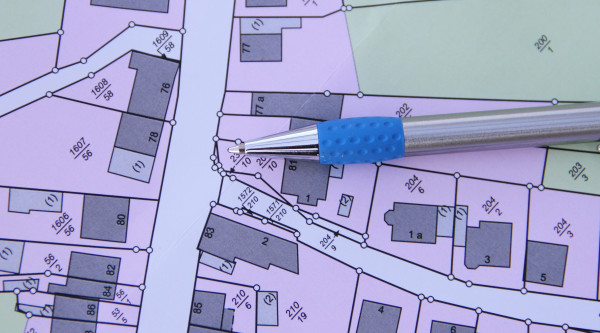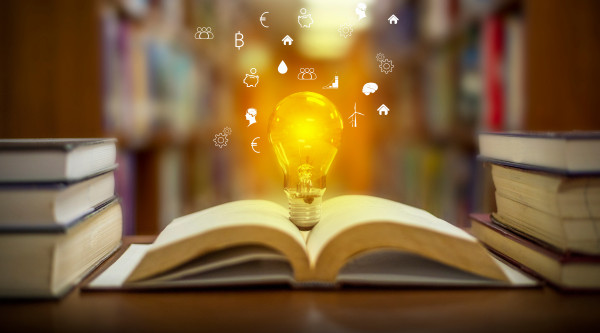Digitalisierung als Schlüssel für eine effiziente Verwaltung
CIO Dr. Daniela Dylakiewicz im VdZ-Interview
Verwaltung der Zukunft: Frau Dr. Dylakiewicz, welche Prioritäten setzen Sie als CIO des Freistaates Sachsen für die kommenden Jahre?
Dr. Daniela Dylakiewicz: Sachsen befindet sich mitten in der digitalen Transformation. Mit dem Ziel eine zukunftsfähige digitale Verwaltung aufzubauen, ist es meine Aufgabe, die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse auf staatlicher und kommunaler Ebene sowohl gegenüber Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen als auch verwaltungsintern weiter voranzutreiben.
Der Freistaat Sachsen wird zusammen mit den Kommunen auch in den kommenden Jahren daran arbeiten, die wichtigsten Verwaltungsleistungen für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen digital zur Verfügung zu stellen. Schon heute gibt es eine Vielzahl von Leistungen, die bequem online beantragt werden können, z. B. das Wohngeld oder das Elterngeld sowie Leistungen in der digitalen Bauverwaltung oder im Meldewesen. Diese sind aber noch nicht überall im Freistaat Sachsen verfügbar. Es ist mir wichtig, das zu ändern. Einen partnerschaftlichen Austausch auf Augenhöhe mit den Kommunen halte ich dabei für essentiell. Sie sind in der Regel die erste Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen. Nur mit einer engen Zusammenarbeit zwischen Freistaat, Landkreisen und Städten wird es uns gelingen, die Bedarfe zu erkennen und passende Lösungen zur Nachnutzung anzubieten. Wir müssen vermeiden, dass jedes Rathaus, jede Stadtverwaltung und jedes Landratsamt sich mit denselben Fragen beschäftigt und am Ende jeder zu einer anderen Lösung kommt.
Verwaltungsintern liegt die Priorität ganz klar bei den IT-Großvorhaben des Freistaates Sachsen. Das sind im Wesentlichen die Projekte SVN NG und ePM.SAX. Sie sind wichtige Meilensteine in der Weiterentwicklung unserer IT-Landschaft. Das Projekt Sächsisches Verwaltungsnetz Next Generation (SVN NG) dient dazu, die technische Kommunikationsinfrastruktur des Freistaates Sachsen zu sichern und ist damit essentiell für die Funktions- und Arbeitsfähigkeit der Staats- und Kommunalverwaltung. Das Projekt ePM.SAX verfolgt das Ziel, eine landeseinheitliche Personalmanagementsoftware einschließlich einer elektronischen Personalakte in der Kernverwaltung der Sächsischen Staatsverwaltung einzuführen. Mit dieser Lösung sollen die bewerbungs- und personalverwaltenden Prozesse sowie die Prozesse der Arbeits- und Dienstzeitplanung sowie -abrechnung auf Basis einer zukunftssicheren und funktionsfähigen Software und IT-Grundlage zuverlässig abgebildet werden. Die Standardisierung und Migration der staatlichen IT-Infrastruktur in ein gemeinsames neues Rechenzentrum ist ein weiteres Thema, das in den nächsten Jahren im Mittelpunkt steht.
VdZ: Sachsen verfolgt mit „sachsen digital 2030“ eine ambitionierte Digitalstrategie. Wo stehen Sie aktuell in der Umsetzung und kann der ursprüngliche Zeitplan eingehalten werden? Welche konkreten Erfolgskriterien und messbaren Zielindikatoren gibt es für die einzelnen Handlungsfelder der Strategie?
Dr. Dylakiewicz: Die Dachstrategie „sachsen digital 2030“ umfasst verschiedene Facetten der Digitalisierung im Freistaat Sachsen: von Bildung und Wissenschaft über Infrastruktur bis hin zur Wissenschaft. Eine der wesentlichen Säulen fällt in meinen Verantwortungsbereich – die digitale Transformation der sächsischen Verwaltung. Die Verwaltungsdigitalisierung ist dabei ein wichtiger Teil der Staatsmodernisierung: Aufbau- und Ablauforganisation, Prozessoptimierung, personelle Ressourcen und Digitalisierung gehören untrennbar zusammen, um Verwaltungsleistungen optimal für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen erbringen zu können.
Derzeit sind wir mitten im Umsetzungsprozess. So haben wir im letzten Jahr, innerhalb der Umsetzungsfrist der NIS-2-Richtlinie, unser Sächsisches Informationssicherheitsgesetz modernisiert. Im Juni 2023 hat das Kabinett die Open Source-Strategie der Sächsischen Staatsverwaltung verabschiedet. Im November 2023 folgte dann die Strategie zur digitalen Transformation der Sächsischen Staatsverwaltung, die für den Freistaat Sachsen das Zielbild eines modernen, leistungsfähigen Dienstleisters für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen formuliert. Außerdem überarbeiten wir gerade unser Sächsisches E-Government-Gesetz. Ziel ist es, eine unbürokratische, zeitgemäße, flexible und zukunftsfähige Rechtsgrundlage für die digitale Verwaltung in Sachsen zu schaffen.
VdZ: Wie bewerten Sie den Stand der Verwaltungsdigitalisierung in Sachsen im bundesweiten Vergleich und wo möchten Sie perspektivisch noch hin?
Dr. Dylakiewicz: Das Bild vom Marathonlauf passt sehr gut, auch in Sachsen: Für digitale Erfolge braucht es einen langen Atem. Das Onlinezugangsgesetz (OZG) hat im Freistaat Sachsen für einen Digitalisierungsschub gesorgt. Auf unserem zentralen Online-Serviceportal Amt24 sind z.B. mittlerweile knapp 200 Online-Anträge verfügbar. Und unser Beteiligungsportal hat sich zum Exportschlager entwickelt, inzwischen nutzen es auch zahlreiche Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.
Für mich liegt der entscheidende Schwerpunkt nun auf einem Gleichklang von Geschwindigkeit und Flächendeckung. Wir müssen Verwaltungsleistungen schneller entwickeln und in die kleinsten Kommunen Sachsens bringen. Nur so kann die Digitalisierung ihre Effizienzversprechen für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, aber auch für die Verwaltung selbst, einlösen. Dazu sollten die Kommunen noch mehr organisatorisch, technisch und finanziell unterstützt werden, z.B. durch die zentrale Bereitstellung von Online-Diensten. Auch der Bund ist hier in der Pflicht, mehr zentrale Verantwortung in der Digitalisierung zu übernehmen. Der neue Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger hat hier aus meiner Sicht erste positive Signale gesendet. Jetzt gilt es, diese mit Leben zu erfüllen.
VdZ: Ihr Vorgänger, Prof. Popp, betonte im VdZ-Interview im Januar 2024, dass ein Schwerpunkt auf der Anbindung an Fachverfahren liege. Wie weit sind Sie im August 2025 mit diesem Vorhaben?
Dr. Dylakiewicz: Die Anbindung an Fachverfahren ist nach wie vor ein Schwerpunkt, denn nur so kann eine echte Ende-zu-Ende-Digitalisierung erreicht werden – von der Antragstellung über die Bearbeitung bis hin zum Versand des Bescheids über einen digitalen Rückkanal und entsprechender Ablage in einer elektronischen Akte. Auf staatlicher Ebene haben wir mit der eAkte unsere Hausaufgaben gemacht. Amt24 und EfA-Dienste werden über Schnittstellen an die eAkte angeschlossen, sodass eine medienbruchfreie Weiterverarbeitung der Online-Anträge möglich ist.
Aktuell liegt der Fokus bei kommunalen Fachverfahren, um die sächsischen Kommunen weiter zu unterstützen. Schritt für Schritt identifizieren wir gemeinsam mit den fachlich zuständigen Ressorts und den kommunalen Landesverbänden Fachverfahren, deren Anbindung an Online-Dienste zentral finanziert wird. So wird beispielsweise der EfA-Dienst eWaffe schon bei der Pilotierung an das Fachverfahren Condition angebunden. Die Kosten hierfür werden zentral getragen. Auch bei der „Digitalen Wohnsitzummeldung“ bzw. der elektronischen Wohnsitzanmeldung (eWA) haben wir bezüglich der Finanzierung und Anbindung an das Fachverfahren gute Fortschritte erzielt.
Eine Herausforderung dabei bleibt die zersplitterte Fachverfahrenslandschaft im kommunalen Raum. Allein bei den Baugenehmigungen sind zehn unterschiedliche Fachverfahren eingesetzt. Hier sollte dringend reduziert werden, damit die Anbindung wirtschaftlich bleibt. Dazu befinden wir uns in einem intensiven und konstruktiven Austausch mit den Fachverantwortlichen.
VdZ: Das Prinzip der digitalen Souveränität ist zentral für moderne Verwaltungs-IT. Wie setzen Sie dieses Ziel konkret um – insbesondere im Hinblick auf Abhängigkeiten von nicht-europäischen Anbietern?
Mehr zur Serie: Die CIOs & CDOs der Bundesländer im Interview
🔗 Digitalisierung, die ankommt: Bürgerzentrierte Verwaltung
Dr. Denis Alt im Interview
Dr. Dylakiewicz: Die derzeitige Dynamik in der internationalen Politik führt auch im Freistaat Sachsen dazu, dass wir IT-Abhängigkeiten neu bewerten. Ziel ist, unsere hoheitlichen Aufgaben selbstständig, selbstbestimmt und sicher ausüben zu können. Dabei müssen insbesondere Abhängigkeiten von Dritten reduziert oder idealerweise ganz vermieden werden. Das Ganze hat mehrere Dimensionen. Zum einen müssen sich Bund und Länder stärker vernetzen und kooperieren, wie z.B. im Rahmen der Deutschen Verwaltungscloud und ZenDiS (Zentrum für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung). Außerdem braucht es ein modernes Beschaffungswesen mit einer stärkeren Gewichtung der digitalen Souveränität. Nicht zuletzt ist entsprechend unserer sächsischen Open Source-Strategie eine Ausrichtung auf Open Source-Lösungen in der Verwaltung unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen im Freistaat Sachsen notwendig.
Erste Erfolge konnten bereits erzielt werden: Sachsen führte als Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) für das bundesweite Arbeiten die Open Source-Lösung „openDesk“ von ZenDiS ein. Wir waren dann auch der erste Nutzer, der die von der öffentlichen Hand entwickelte Lösung produktiv eingesetzte. Diese hat sich aus Sicht aller Beteiligten und nicht zuletzt des IT-Planungsrates bewährt. Im Herbst wird Rheinland-Pfalz den MPK-Vorsitz übernehmen und weiter auf „openDesk“ setzen. Darüber hinaus prüfen wir derzeit den Einsatz von „openDesk“ in der Staatsverwaltung.
VdZ: Auch ökologische Nachhaltigkeit wird als Leitprinzip in der Strategie genannt. Wie wird sie im IT-Bereich praktisch umgesetzt, etwa durch Green-IT oder energieeffiziente Rechenzentren?
Dr. Dylakiewicz: Wir arbeiten intensiv in der Kooperationsgruppe Green-IT des IT-Planungsrates mit. Dabei sind bereits mehrere Handlungsleitfäden entstanden. Die Landesliegenschaften sollen zudem bis 2026 vollständig mit Ökostrom versorgt werden; ein Großteil ist es bereits. Und nicht zuletzt wird durch die Konsolidierung unserer Rechenzentrumsinfrastruktur auf Landesebene die Anzahl eingesetzter Hardware und damit der Energieverbrauch insgesamt reduziert. Neben der energie- und ressourceneffizienten Bündelung unsere Rechenzentrenkapazitäten setzen wir auch auf die Minimierung der Endgeräteanzahl je Mitarbeitenden. Die konsequente Umsetzung der Ein-Geräte-Strategie wird zur Reduzierung des Energieverbrauchs, der Ressourcenverschwendung und des anfallenden Elektroschrotts beitragen.
VdZ: Wie kann gewährleistet werden, dass digitale Innovationen nicht nur in wirtschaftsstarken Regionen ankommen, sondern auch strukturschwache Räume nachhaltig erreichen?
Dr. Dylakiewicz: Klar ist: Die Digitalisierung ist eine enorme Herausforderung für die Kommunen, vor allem in strukturschwachen Regionen. Gleichzeitig kann eine digitale Verwaltung ihre Leistungen auch in der kleinsten Kommune anbieten, ohne zwingend vor Ort präsent zu sein. Sie kann dadurch mit dazu beitragen, dass junge Familien gern in ländliche Räume ziehen. Denn den Bürgerinnen und Bürgern ist es am Ende egal, ob sie in Torgau eine Verwaltungsdienstleistung beantragen, die in Görlitz erbracht wird, und umgekehrt. Mittel- bis langfristig kann die Digitalisierung also dazu beitragen, strukturelle Ungleichgewichte auszugleichen.
Der Freistaat unterstützt die kommunale Digitalisierung auf vielfältige Weise:
Beispielsweise werden den sächsischen Kommunen zentral finanzierte Online-Dienste unentgeltlich bereitgestellt, darunter EfA-Dienste wie Digitale Baugenehmigung, Sozialplattform oder Aufenthaltstitel, aber auch Eigenentwicklungen wie Wohngeld und Marktlösungen im Meldewesen. Der Schwerpunkt liegt, wie schon erwähnt, darin, die Online-Dienste weiterzuentwickeln und an die Fachverfahren anzubinden. Darüber hinaus hat sich das Projekt „Digital-Lotsen-Sachsen“ bewährt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den kommunalen Verwaltungen werden hier gezielt geschult, um Digitalisierungsprojekte vor Ort planen und umsetzen zu können. Mit dem Projekt digitale Vorgangs- und Aktenbearbeitung (DiVA) wollen wir sächsische Kommunen zudem in die Lage versetzen, die für die eAkte nötigen Systeme und Prozesse aufzubauen.
VdZ: Was hat Sie persönlich motiviert, sich so intensiv mit Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung zu beschäftigen? Was treibt Sie heute in Ihrer Rolle als CIO an?
Dr. Dylakiewicz: Meine persönliche Motivation gründet auf der Überzeugung, dass eine leistungsfähige und bürgerorientierte Verwaltung eine unverzichtbare Säule unseres demokratischen Gemeinwesens ist. Die Möglichkeiten, die digitale Technologien bieten, um Verwaltungsprozesse effizienter, transparenter und serviceorientierter zu gestalten, entwickeln sich rasant. Gleichzeitig sehe ich in der Modernisierung der Verwaltung eine gesellschaftliche Verantwortung, um den steigenden Anforderungen an Schnelligkeit, Qualität und Zugänglichkeit von Verwaltungsleistungen gerecht zu werden. Diese Kombination aus technologischem Fortschritt und gesellschaftlichem Auftrag macht die Aufgabe so spannend.
Als Chief Information Officer ist es meine Aufgabe, eine ganzheitliche und nachhaltige IT-Strategie für die Landesverwaltung umzusetzen. Meine Mission ist es, die digitale Transformation als Katalysator für eine zukunftsfähige Verwaltung zu nutzen und dabei sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch den Mitarbeitenden optimale Rahmenbedingungen zu bieten. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und der digitalen Angebote erfordert ein hohes Maß an Innovationsbereitschaft, Koordinationsfähigkeit und strategischem Weitblick. Diesen Anforderungen möchte ich mit meinem Engagement gerecht werden.