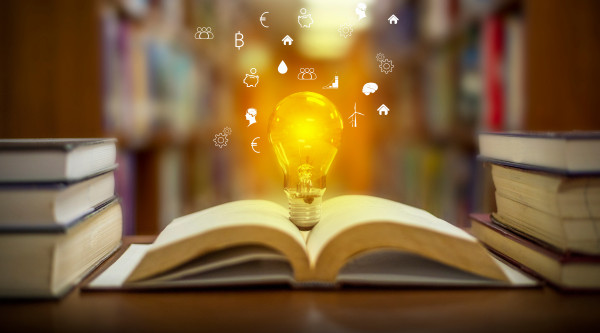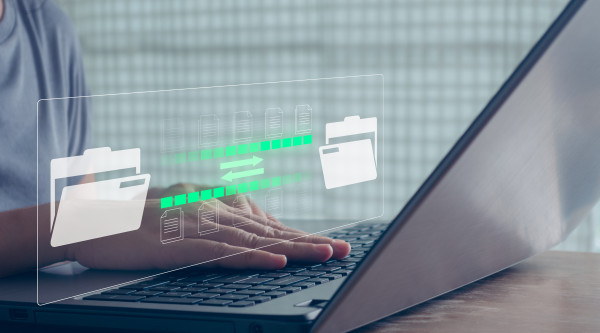Im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen sind Prof. Dr. Nathalie Behnke und Jonas Bernhard, Technische Universität Darmstadt, der Frage nachgegangen, worin kulturelle Ursachen der Überbürokratisierung liegen könnten und worin die Herausforderungen bestehen, um Fehlentwicklungen zu überwinden.
1. Kulturelle Hintergründe
Die Studie zeigt, dass die Überbürokratisierung in Deutschland nicht nur durch Überregulierung und föderale Strukturen bedingt ist, sondern ihre Wurzeln in der Verwaltung- und Gesetzgebungskultur hat. Diese sind geprägt durch eine
- legalistische Verwaltungstradition: Die deutsche Verwaltung orientiert sich stark am Prinzip der Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit. Entscheidungen werden häufig risikoscheu und formalistisch getroffen. Ermessensspielräume werden selten genutzt, aus Angst vor Fehlern und rechtlichen Konsequenzen.
- Absicherungsmentalität: Verwaltungsmitarbeitende neigen dazu, sich durch zusätzliche Gutachten und Nachweise abzusichern. Rechtsprechung sowie Rechnungshöfe verstärken diese Tendenz. Die Ablehnung eines Antrags gilt oft als „sicherste“ Entscheidung.
- Silodenken und Spezialisierung: Rechtsbereiche entwickeln sich unabgestimmt voneinander. Fachbehörden agieren isoliert. Dies führt zu widersprüchlichen Anforderungen. Ausbildung und Karrierewege vor allem der Juristen fördern Spezialistentum, nicht Generalistentum.
- Perfektion: Legistinnen und Legisten legen bei Gesetzesentwürfen oft großen Wert auf juristische Perfektion statt auf Praxisbezug und Pragmatismus. Die geringe Personalfluktuation und Eigenlogik der Ministerien verhindern Reformen. Die Rückmeldungen aus der Praxis werden selten systematisch berücksichtigt.
2. Selbstwahrnehmung der Verwaltung
Die Interviews mit Verwaltungsmitarbeitenden haben gezeigt, dass sie sich selbst als rechtsstaatlich handelnde Akteure sehen und nicht als Bürokratietreiber. Viele empfinden Bürokratie als notwendig, um Ordnung und Gleichbehandlung sicherzustellen. Gleichzeitig wird die eigene Rolle als restriktiv und wenig gestaltend erlebt. Ähnliche Ergebnisse haben die Interviews mit Vertretern der Ministerialverwaltung ergeben. Sie erkennen zwar das Problem der Überregulierung, sehen aber politischen Druck und gesellschaftliche Erwartungen als Ursache. Die Eigenlogik der Gesetzgebung führe zu immer detaillierteren und komplexeren Regelungen. Und es fehle an Zeit, Praxischecks und Evaluationsmechanismen.
3. Wo liegt die Lösung?
Notwendig ist ein grundlegender Kulturwandel in der Politik, bei den Legistinnen und Legisten sowie in der Verwaltung, nicht zuletzt in der Gesellschaft selbst. Zunächst gilt allgemein:
- Weg von einer Kultur der Absicherung hin zu einer Kultur des Ermöglichens,
- Misstrauen durch Zutrauen ersetzen,
- Kontrolle durch Eigenverantwortung ersetzen,
- Statt Angst vor Fehlern, die Handlungsfolgen autonom abschätzen,
- sich nicht am Buchstaben des Gesetzes orientieren, sondern am Zweck der Regelung,
- einen Mindsetwechsel der Gesellschaft herbeiführen.
Gesetzgebung
In Folge eines solchen Kulturwandels ist der Gesetzgeber gehalten, die Vorschriften stark zu reduzieren und zu harmonisieren, auf Detailregelungen zu verzichten und stattdessen mehr Ermessensspielräume für die Verwaltung vorzusehen. Es sollten Praxischecks und Reallabore durchgeführt werden, um die Umsetzbarkeit von Regelungen zu prüfen. Vorschriften sollten ein Ablaufdatum erhalten und regelmäßig evaluiert werden. Schließlich ist wichtig, dass sich der Gesetzgeber mehr Zeit für die Gesetzesformulierung und die Beteiligung der Vollzugsebene nimmt.
Die Ausbildung der Juristen und Verwaltungswissenschaftler sollte reformiert und das Generalistentum gestärkt werden.
Verwaltung
Für die Vollzugsverwaltung empfiehlt die Studie, dass Führungskräfte Verantwortung übernehmen und Mitarbeitende ermutigen sollen, Spielräume zu nutzen. Die Beratung vor der Antragstellung und Verhandlungslösungen würden Verfahren beschleunigen. Schließlich fördern Positionswechsel und Betriebspraktika den Perspektivwechsel und damit das Verständnis für Antragsteller.
Gesellschaft
Die Bevölkerung stellt hohe Anforderungen an Schutzregeln (Brandschutz, Datenschutz, Arbeitsschutz, Artenschutz, Klimaschutz etc.). Diese werden von Interessengruppen im Klageweg eingefordert, wodurch die Politik unter Druck gerät und den Anforderungen nachgibt. Häufig wird gefordert, dass der Staat jedes individuelle Risiko abdeckt. Auch in der Gesellschaft muss ein Umdenken stattfinden.
📥 Kostenloser Download für VdZ|Plus-Leser*innen
Leser*innen mit einem VdZ|Plus-Konto können sich im anschließenden Bereich die Studie als PDF runterladen. Die Studie kann abgerufen werden unter: https://www.familienunternehmen.de
➡️ Interessierte ohne Konto können sich einfach kostenlos über diesen Link für VdZ|Plus registrieren.
VdZ|Plus-Leser*innen haben Zugriff auf vertiefende Materialien rund um die Digitalisierung des öffentlichen Sektors: Studien, Whitepapers, Tagungsunterlagen und exklusives Videomaterial
Exklusiver Inhalt für unsere VDZ-Plus-Leser
Loggen Sie sich hier ein oder
Registrieren Sie sich als VDZ-Plus-Leser.