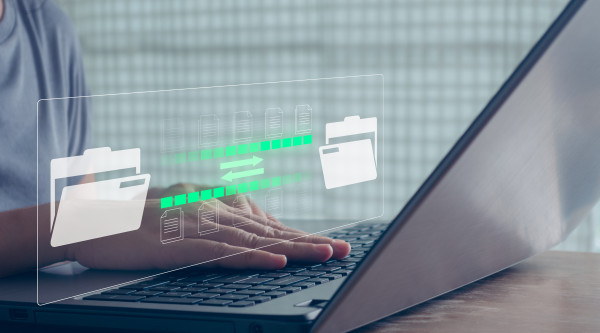Bargeld oder Karte? Wie sich das Bezahlen im öffentlichen Dienst verändert
In vielen europäischen Nachbarstaaten ist bargeldloses Bezahlen längst Teil des Alltags. Die Niederlande sind eines der prominentesten Beispiele: Ob im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt oder im Rathaus, fast überall wird digital gezahlt. Die Zahlen sprechen für sich: Rund 90 Prozent der Bürger zahlen dort bargeldlos. In Deutschland dagegen ist Bargeld nach wie vor ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens, besonders in der Verwaltung.
Doch warum ist das so? Und wie könnte eine moderne Bezahlinfrastruktur in der öffentlichen Hand aussehen? Ein Blick in die Praxis zeigt: Der Umstieg bringt viele Chancen mit sich, aber auch Herausforderungen, die nicht allein technischer Natur sind.
Warum hält Deutschland am Bargeld fest?
Wer durch deutsche Städte schlendert, bemerkt schnell: Es gibt noch große Unsicherheiten und Uneinigkeiten. Das Restaurant nebenan nimmt nur Bargeld an, der Parkscheinautomat nimmt nur noch Kartenzahlung entgegen – und dann ist er auch noch defekt (wie das folgende Beispiel zeigt).
Solche Situation verstärken die Unsicherheit und das Vertrauen in digitale Zahlungen. Auch wenn sich in vielen Bereichen die Kartenzahlung etabliert hat, ist der Griff zum Geldschein vielerorts noch Gewohnheit. Ein Grund dafür könnte in der deutschen Geschichte liegen:
Währungskrisen wie die Hyperinflation in den 1920er Jahren oder die Umstellung zur D-Mark nach dem Zweiten Weltkrieg haben Spuren hinterlassen. „Nur Bares ist Wahres“ – ein geflügeltes Wort, das nicht nur älteren Generationen im Ohr liegt. Bargeld vermittelt ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit. Man sieht, was man hat. Und was man hat, das hat man.
Gleichzeitig empfinden viele den Zugang zu Bargeld als zunehmend mühsam. Laut einer Bundesbank-Studie von 2023 gaben 15 Prozent der Befragten an, dass es schwierig sei, einen Geldautomaten zu erreichen – doppelt so viele wie zwei Jahre zuvor.
Zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Wie Deutschland zahlt
Trotz der kulturellen Prägung hin zum Bargeld verändert sich das Zahlungsverhalten allmählich. Laut Bundesbank wurde 2023 nur noch rund die Hälfte aller Transaktionen mit Bargeld getätigt. Besonders in größeren Städten und bei jüngeren Menschen dominiert die Kartenzahlung.
Spannend ist dabei: 44 Prozent der Befragten würden am liebsten unbar zahlen, wenn sie die freie Wahl hätten. Doch oft fehlt schlicht die Möglichkeit, besonders in öffentlichen Einrichtungen.
Bezahlen in der Behörde: Komplexität trifft Alltag
Ein Blick in deutsche Rathäuser zeigt: Bargeld ist vielerorts noch Standard. Das liegt nicht nur an der Technik, sondern oft an Strukturen. Fachbereiche arbeiten mit eigenen (Hand-)Kassen, Buchungen laufen manuell, und Zahlungsprozesse ziehen sich durch zahlreiche Abteilungen. Hinzu kommen Datenschutzbedenken, Unsicherheit im Umgang mit digitalen Zahlungsdaten und veraltete Softwarelandschaften.
Oft heißt es dann: „Das haben wir immer so gemacht.“ Doch genau hier liegt die Chance. Denn digitale Bezahlprozesse bieten nicht nur Komfort für die Bürger, sondern auch Effizienz für die Verwaltung.
Was digitale Bezahlprozesse wirklich bringen
Die Vorteile liegen auf der Hand:
- Zeitersparnis: Weniger Wartezeiten, schnellere Bearbeitung
- Fehlerreduzierung: Automatisierte Buchungen reduzieren Rechenfehler
- Sicherheit: Keine Bargeldkassen bedeuten weniger Diebstahlrisiko
- Transparenz: Jeder Schritt ist digital nachvollziehbar
Darüber hinaus entlastet der digitale Zahlungsverkehr Mitarbeitende, da Routineaufgaben wegfallen.
Niederlande: Wie eine Verwaltung digitale Zahlungen anbietet
In niederländischen Gemeinden ist die digitale Zahlung längst Standard. Behördengänge lassen sich online vorbereiten und die Bezahlung mithilfe einer Software für Zahlungsabwicklungen vorab online (etwa 50 % der Personalausweise und Reisepässe), per Karte oder vor Ort durchführen. Die modernen Kassensysteme sind direkt mit der Finanzverwaltung und mit dem BRP (Basisregistratie Personen, vergleichbar mit dem deutschen Melderegister) verknüpft. Durch die Nutzung eines Kassensystems und die Integration in die zuvor genannten Systeme werden Zahlungsprozesse automatisiert, fehlerfrei dokumentiert und sind deutlich sicherer.
Dabei wird das Bargeld nicht komplett aus dem Zahlungsprozess verbannt, denn es gibt auch in den Niederlanden Bevölkerungsgruppen, die die Zahlung mit Bargeld bevorzugen oder kein Bankkonto besitzen. Den Bürgern wird weiterhin die Option gelassen ihre Zahlweise auszusuchen. Aber diese sind nun an digitale, sichere und genaue Prozesse angeknüpft.
Die wenigen Bargeldzahlungen laufen automatisiert über spezielle Kassenautomaten und ersetzen klassische Kassen. Somit haben die Mitarbeiter keinen Kontakt mehr mit Bargeld. Das schafft Raum und Zeit für wichtigere Aufgaben – sich persönlich um die Bürger zu kümmern.
Auch organisatorisch wirkt sich das positiv aus. Unstimmigkeiten in der Kasse, die früher schnell zu Vertrauensproblemen unter den Mitarbeitern führten, werden durch transparente Abläufe, automatisierte Kassenberichte und versiegelte Bargeldtransporte vermieden.
Eine kleine Anekdote: Wenn der Bürger keine Wahl mehr hat
Die Gemeinde Leiden schaffte Bargeld im Jahr 2014 ganz ab. Erst ein rechtlicher Hinweis führte 2018 zur Wiedereinführung. Das Kuriose: Niemand hatte in der Zwischenzeit nach Barzahlung gefragt. Trotzdem musste für mehrere Zehntausend Euro Infrastruktur geschaffen werden – allein, um gesetzeskonform zu bleiben.
Fazit: Mehr als eine technische Entscheidung
Die Frage „Bargeld oder Karte?“ ist letztlich eine Vertrauensfrage. Vertrauen in Prozesse, Technik und Menschen. Die Niederlande zeigen, dass digitale Bezahlprozesse funktionieren, wenn man sie ganzheitlich denkt.
Auch in Deutschland zeigt sich ein Trend, dass digitale Zahlungen immer mehr an Vertrauen gewinnen. Klar ist: Die Zukunft ist digital. Aber nur, wenn der Wandel bewusst gestaltet wird – mit Sicherheit, Transparenz und Wahlfreiheit für alle Beteiligten.