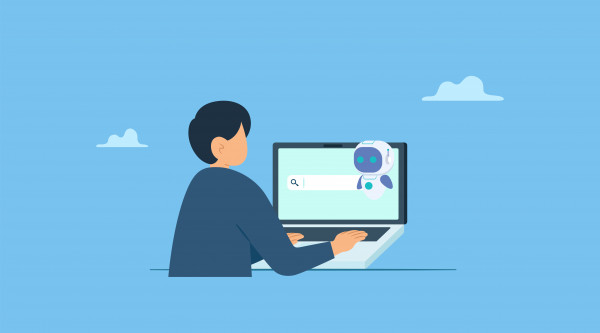Zwischen Kulturwandel, KI-Kompetenz und ethischer Verantwortung
Zukunftsfähiges HR im öffentlichen Sektor
Der öffentliche Dienst im Umbruch: Warum sich HR grundlegend verändern muss
Trotz steigender Beschäftigtenzahlen (5,27 Mio., DGB 2024) verschärfen sich die strukturellen Probleme: 27 % der Mitarbeitenden sind über 55 und nähern sich dem Ruhestand, während gleichzeitig die Teilzeitquote auf über 35 % gestiegen ist – oft aus Gründen der Überlastung oder fehlender Vereinbarkeit (DGB 2024). Fachkräftemangel, demografischer Wandel und kulturelle Spannungen machen deutlich: HR muss heute mehr leisten als Personalverwaltung.
Gefragt ist ein vorausschauendes, generationensensibles und wertebasiertes HR-Management, das Wandel aktiv gestaltet: digital kompetent, strategisch verankert und mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit der Verwaltung.
Sinnvolle Kennzahlen statt reiner Output-Logik
In der Vergangenheit standen im HR-Controlling vor allem quantitative Kennzahlen im Vordergrund: Kosten pro Einstellung, Bearbeitungsdauer von Vorgängen oder Krankheitstage. Doch diese greifen zu kurz, wenn HR eine strategische Rolle einnehmen soll. Es braucht „Meaningful Metrics“, die Wirkung und Sinn abbilden; messbare Indikatoren, die nicht nur Effizienz, sondern auch den Kulturzustand einer Organisation zeigen.
Beispiele für „Meaningful Metrics“:
- Mitarbeitendenbindung: Sinkende Fluktuation guter Kräfte oder verlängerte Verweildauer deuten auf ein besseres Arbeitsumfeld hin.
- Engagement-Scores: Regelmäßige Befragungen zeigen, ob sich Mitarbeitende mit den Zielen der Organisation identifizieren und wie sehr sie sich einbringen möchten.
- Diversität und Inklusion: Der Anteil unterrepräsentierter Gruppen in Führung, Gender Pay Gap oder wahrgenommene Chancengleichheit liefern Hinweise, ob Werte auch gelebt werden.
- Lern- und Innovationsindikatoren: Teilnahme an Weiterbildungen, Zahl eingereichter Verbesserungsvorschläge oder Beiträge in interdisziplinären Projekten lassen Rückschlüsse auf Innovationskultur und Veränderungsbereitschaft zu.
Diese Daten zeigen: Kultur ist steuerbar. HR sollte dabei nicht nur „zählen, was es tut“, sondern „messen, wie es wirkt“. Entscheidend ist nicht allein der Indikator, sondern vielmehr die Reflexion darüber, was er bedeutet und wie er verbessert werden kann.
KI im HR: Werkzeug, nicht Wunderwaffe
Künstliche Intelligenz zieht zunehmend in den HR-Alltag ein, z. B. bei der Texterstellung, der Analyse von Mitarbeitendenbefragungen oder als virtuelle Assistenz im Bewerbungsprozess. Auch der öffentliche Sektor ist davon betroffen. Tools wie ChatGPT, Copilot & Co. unterstützen dabei, Informationen schneller zu verarbeiten und Inhalte effizient zu generieren.
Doch wer KI nutzen will, braucht Kompetenz in vier zentralen Bereichen:
a) Grundverständnis von KI-Funktionalität
HR muss kein IT-Experte sein, aber verstehen, dass KI-Modelle wie ChatGPT auf riesigen Datenmengen basieren und Wahrscheinlichkeiten berechnen, nicht „wahr“ im klassischen Sinne sind. Sie reproduzieren Muster aus Trainingsdaten, somit auch Fehler oder Verzerrungen. HR muss hierfür sensibilisiert werden.
b) Prompt-Kompetenz
Gute Ergebnisse erfordern gute Fragen. „Prompt Engineering“ beschreibt die Fähigkeit, präzise, kontextbezogene und strukturierte Anfragen zu formulieren. Nur so wird KI vom Zufallsgenerator zum echten Assistenzsystem mit Mehrwert. Je besser die Eingaben, desto besser die Ergebnisse.
c) Datenschutz und Governance
Im öffentlichen Sektor gelten besonders hohe Datenschutzstandards. Personenbezogene oder vertrauliche Informationen dürfen nicht unkontrolliert in offene KI-Systeme eingegeben werden.
Mit dem Inkrafttreten des EU AI Act am 1. August 2024 und der schrittweisen Umsetzung bis 2027 werden zusätzliche Pflichten eingeführt. Systeme zur Auswahl, Bewertung oder Entwicklung von Mitarbeitenden gelten künftig als Hochrisiko-KI und müssen strengen Anforderungen genügen. Dazu gehören unter anderem Transparenz, Protokollierung und menschliche Kontrolle.
Für HR bedeutet das: KI darf unterstützen, aber nicht intransparent entscheiden. Governance, klare Leitlinien, Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeitenden sind unerlässlich, um rechtssicher, ethisch und verantwortungsvoll mit KI zu arbeiten.
d) Change-Kompetenz
Die Einführung von KI ist nie nur ein Toolprojekt, sondern ein Veränderungsprozess. HR muss Mitarbeitende mitnehmen, Ängste ernst nehmen („Verliere ich meinen Job?“) und den Mehrwert greifbar machen. Dafür eignen sich Schulungen, offene Test- bzw. Pilotphasen und dialogorientierte Formate wie Peer-Coachings. Menschen sollen erleben, dass KI Routinearbeit erleichtert, nicht Menschlichkeit ersetzt.
Ethik als strategische Notwendigkeit
Im Umgang mit KI, Daten und neuen Arbeitsformen braucht es ethische Leitplanken. Gerade im öffentlichen Dienst, als Vorbild in Sachen Integrität, Gemeinwohl und Rechtsstaatlichkeit, ist verantwortliches Handeln entscheidend.
Drei zentrale ethische Herausforderungen:
- Diskriminierung vermeiden: KI kann Vorurteile verstärken, wenn sie mit einseitigen Daten trainiert wurde. Deshalb braucht es Bias-Checks und eine kontinuierliche Prüfung von Auswahlprozessen auf Fairness.
- Transparenz schaffen: Mitarbeitende und Bewerbende müssen nachvollziehen können, wie Entscheidungen zustande kommen, ob bei der Personalauswahl oder in Entwicklungsprogrammen.
- Verantwortung behalten: KI darf vorbereiten, aber nicht entscheiden. HR trifft Entscheidungen und trägt die Verantwortung für deren gesellschaftliche Wirkung.
Lebensphasenorientierung und Generation Z:
Differenzieren statt pauschalisieren
Ein zukunftsorientiertes HR denkt nicht nur in Stellen, sondern in Lebensphasen, Bedürfnissen und Potenzialen. Ältere Mitarbeitende brauchen andere Unterstützung als Berufseinsteigende. Jüngere Generationen verlangen vermehrt nach Sinn, Feedback, Entwicklung und Diversität.
Konkret kann das u. a. bedeuten:
- für Berufseinsteigende z. B. Mentoring, flexible Karrierepfade, transparente Feedback- und Entwicklungssysteme.
- für die Lebensmitte z. B. Vereinbarkeit von Familie und Führung, Möglichkeiten zum Quereinstieg oder zur Neuorientierung.
- für ältere Mitarbeitende z. B. Gesundheitsmanagement, gleitende Übergänge in den Ruhestand, Programme zum Wissenstransfer.
HR sollte unterschiedliche Lebensrealitäten sichtbar machen und nicht mit „one-size-fits-all“-Maßnahmen reagieren. Generation Z etwa achtet verstärkt auf Nachhaltigkeit, Mitbestimmung und digitale Selbstwirksamkeit. Wer das ignoriert, verliert Talente – nicht weil er zu wenig zahlt, sondern weil die Haltung nicht überzeugt. Natürlich gilt dabei: Auch Generationen sind keine homogenen Gruppen – innerhalb einer Generation gibt es ebenso vielfältige Werte, Lebensentwürfe und Erwartungen wie in jeder anderen Alterskohorte.
HR als strategische Kraft im öffentlichen Sektor
Verwaltung neu zu denken heißt auch: Personal neu zu denken. HR darf kein reiner Vollzugsapparat sein, sondern muss zur strategischen, gestaltungsstarken Einheit werden. Dafür braucht es:
- Kennzahlen, die Wirkung zeigen – jenseits reiner Effizienzlogik.
- KI-Kompetenz, die Mehrwert schafft, ohne zu überfordern.
- Ethik, die Entscheidungen leitet – nicht nur begründet.
- Personalentwicklung, die Vielfalt und Lebensrealitäten ernst nimmt.
Wer es schafft, Technologien intelligent einzusetzen, kulturelle Stärke aufzubauen und dabei Menschlichkeit als Fundament zu verstehen, gestaltet nicht nur HR zukunftsfähig, sondern auch den öffentlichen Sektor als Ganzes. Denn Verwaltung ist dann stark, wenn sie Werte lebt, Wandel gestaltet und Talente bindet.
Quellen:
DGB Personalreport 2024. Online abrufbar unter: https://igbau.de/Binaries/Binary21431/DGB-Personalreport-oeD-2024.pdf (letzter Zugriff: 01.06.2025).