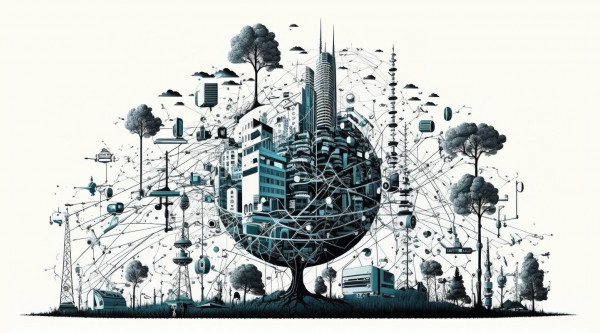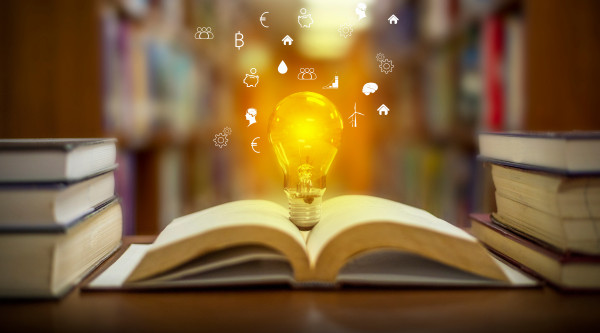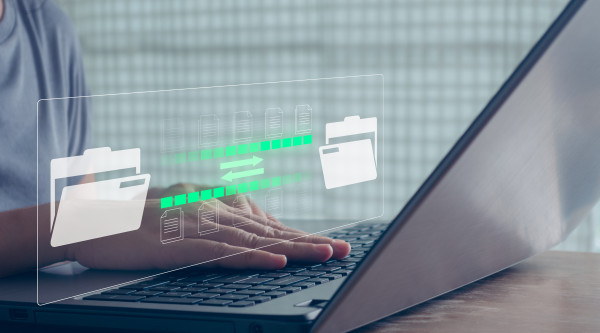Der öffentliche Dienst steht vor einer enormen Herausforderung: Aktuell fehlen 570.000 Beschäftigte, bis 2030 wird sich diese Zahl auf eine Million erhöhen. Das Problem ist akut und erfordert nachhaltige Lösungen, denn einerseits sollen Dienstleistungen digitalisiert und modernisiert werden. Andererseits fehlen vielerorts die Menschen, um diese Transformation zu tragen – Fachkräftemangel, Pensionierungswellen und Nachwuchsprobleme inklusive.
Kein Wunder, dass sich auch der öffentliche Sektor nicht dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) verschließen kann, denn es ist naheliegend, beides zu verbinden und KI in die Verwaltung Einzug halten zu lassen.
KI schreibt Texte, analysiert Stimmungen, erkennt Muster und strukturiert Informationen in Rekordzeit. Sie wird nicht nur in der freien Wirtschaft eingesetzt, sondern auch immer öfter in Rathäusern – etwa in Chatbots für Bürgeranfragen, automatisierten Antragsverfahren oder der Datenanalyse in der Stadtentwicklung. Sie kann standardisierte Prozesse vereinfachen, Ressourcen entlasten, Abläufe beschleunigen. Es gibt bereits Anwendungsfälle, in denen die öffentliche Verwaltung die Vorgangsbearbeitung durch KI erfolgreich vorbereitet.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Standardisierte Prozesse lassen sich automatisieren, personelle Ressourcen werden entlastet, Bearbeitungszeiten sinken – ein effizienter Einstieg in die Automatisierung von Verwaltungsprozessen.
Eine zentrale Frage ist damit jedoch noch nicht beantwortet: Was bedeutet das für die vorhandenen und die künftigen Mitarbeitenden?
KI in der öffentlichen Verwaltung: eine neue Arbeitsteilung
Eine Million unbesetzte Stellen im Jahr 2030. Das ist rechnerisch ein Anteil von ca. 20 %, der nicht mehr besetzt werden kann. Diese Zahlen machen deutlich, dass allein schon rein summarisch die KI keine Mitarbeitenden wird verdrängen können. Dafür werden schlicht nicht mehr genug Mitarbeitende verfügbar sein.
Vielmehr kann KI helfen, Personalengpässe abzufedern und langfristig zu vermeiden. Besonders in Zeiten, in denen viele Stellen unbesetzt bleiben, ist das eine echte Chance.
Zugleich wird KI die Arbeitswelt der Rathäuser und Dienststellen verändern. Sie übernimmt Routinen – und macht damit Platz für anspruchsvollere Aufgaben. Jobs in der Verwaltung werden nicht weniger, sondern komplexer. Mitarbeitende können sich auf individuelle Anliegen konzentrieren, kreative Lösungen entwickeln und in direkter Interaktion mit Bürgerinnen und Bürgern wirken.
Während KI also automatisiert und die Bearbeitungseffizienz steigt, braucht es Menschen dort, wo Menschlichkeit und Empathie gefragt sind. Nicht nur bei individuellen Bürger- und Kundenkontakten, also insbesondere in Bildung, Sozialem und Kultur – wo es nicht um Standardprozesse, Antragsbearbeitung und Auszahlungen, sondern um das Verstehen individueller Lebenslagen geht. Sondern auch in der Führung dieses Personals, denn hier entscheidet sich, ob es gelingt, Mitarbeitende in dieser neuen Realität zu halten, weiterzuentwickeln und emotional zu binden. Dem Buzzword „Retention“ – also der langfristigen Bindung von Mitarbeitenden – wird noch eine viel größere Bedeutung zukommen. Denn es ist absehbar, dass diese grundlegende Veränderung Ängste unter den Mitarbeitenden schüren wird.
Retention: Wie soll besser werden, was schon jetzt nicht hinreichend funktioniert?
Der öffentliche Dienst kämpft nicht nur mit dem Gewinnen neuer Fachkräfte – sondern auch mit dem Halten der gewonnenen und vorhandenen Mitarbeitenden. Besonders alarmierend: Rund ein Drittel der Neueinstellungen kündigt im ersten Jahr wieder. Ein erheblicher Teil davon sind Quereinsteigende, die an starren Strukturen und mangelnder Unterstützung scheitern. Die Kosten sind immens – monetär und menschlich. Hinzu kommt ein weiterer Anteil, der innerlich kündigt und es sich mit den Annehmlichkeiten des öffentlichen Dienstes einrichtet. Das sind keine Vorurteile, sondern die wissenschaftlich ermittelte Realität.
Gleichzeitig steigern KI-Prozesse die Anforderungen und Ansprüche an die bestehende Kultur: Wer seine Arbeitswelt plötzlich in Frage gestellt sieht, braucht mehr als nur eine neue Software – er braucht Führung, Orientierung und Zugehörigkeit.
Empathie ist das verbindende Element in diesem Wandel. Sie schafft Vertrauen, Zugehörigkeit und Motivation. Sie macht Veränderung möglich, ohne zu überfordern. Sie ist das, was KI nicht leisten kann – und deshalb wird sie zum entscheidenden Erfolgsfaktor der Verwaltung von morgen.
Retention beginnt schon vor dem Recruiting
Viele Verwaltungen setzen auf modernes Recruiting, attraktive Arbeitgebermarken und Kampagnen. Das ist wichtig – aber es reicht nicht. Denn Recruiting beginnt mit einem Versprechen, das mit der Arbeitsrealität eingelöst werden soll. Wird das Vertrauen darin enttäuscht, kehren neue Mitarbeitende schnell wieder den Rücken.
Frisch eingestellte Talente treffen bereits heute auf überlastete Teams, ineffiziente Strukturen und fehlende Entwicklungsmöglichkeiten. Die Folgen sind Frustration. Resignation. Kündigung. Dabei ist es nicht KI, die abschreckt. Es sind verkrustete Systeme, fehlende Offenheit und mangelnde emotionale Intelligenz im Umgang mit Mitarbeitenden. Und zukünftig noch mit den beschriebenen Veränderungen.
Retention ist jedoch kein Nice-to-have. Sie wird zur Überlebensstrategie, weil KI eben nicht verhindern wird, dass die Verwaltung händeringend Personal sucht. Und sie ist doppelt anspruchsvoll. Einerseits gilt es, bestehende Mitarbeitende durch Kultur, Entwicklung und Anerkennung zu halten. Andererseits muss der Übergang für neue Kolleg:innen – insbesondere Quereinsteigende – so gestaltet sein, dass sie ankommen, sich zurechtfinden und langfristig bleiben.
Retention ist jedoch kein Nice-to-have. Sie wird zur Überlebensstrategie.
Erfolgsfaktoren für Retention im öffentlichen Dienst
Der Begriff „Retention“ wird heute meist in einem Atemzug mit „Benefits“ genannt. Und ja, Benefits sind ein Baustein, der auf Retention einzahlt. Jedoch nur, wenn sie richtig ausgewählt werden. Was Mitarbeitende sich selbst kaufen können, wie Obst, Fahrräder, Busfahrkarten oder Mitgliedschaften im Fitnessstudio, verfehlt seine Wirkung. Es geht vielmehr um Benefits, die echte Relevanz und Wertschätzung tragen, wie flexible Arbeitszeitmodelle, Gesundheitsangebote, Teamorientierung und Entwicklungsperspektiven.
Doch damit nicht genug. Maßgeblicher Baustein und damit essentieller Erfolgsfaktor bleibt die Empathie. Es braucht Entscheider:innen, die bereit sind, Verantwortung für Kultur zu übernehmen. Die nicht nur Prozesse managen, sondern Sinn stiften, und die für eine Veränderungs- und Teamkultur stehen, die Empathie erlaubt. Es braucht Raum für Emotionen, Fehler und Fragen.
Nicht zuletzt darf all das nicht nur nach innen wirken, denn es bleibt dabei: Retention beginnt vor dem Recruiting. Mit einer Außenwirkung, die zeigt „Wir wissen, wohin wir gehen – und wir kümmern uns um die, die mitgehen.“ Nur so wird die öffentliche Verwaltung die Menschen anziehen und an sich binden können, die sie braucht. Eben solche, die selbst Empathie leben.
Nachhaltige Mitarbeiterbindung beginnt also nicht mit dem ersten Arbeitstag. Sie beginnt viel früher – im Denken der Organisation. Im Aufbau einer Kultur, die attraktiv ist, bevor eine Stelle überhaupt ausgeschrieben wird. Im aktiven Gestalten der Voraussetzungen, unter denen neue sowie bestehende Mitarbeitende gedeihen können.
Die Verwaltung muss sich zuerst selbst fit machen, bevor sie neue Kolleg:innen ins Boot holt. Das senkt die Fluktuationsquoten, erhöht die Zufriedenheit und spart letztlich Kosten. Denn jede Vakanz kostet nicht nur unmittelbar, sondern auch mittelbar Geld – durch Demotivation und Überlastung.
KI und Empathie: Kein Widerspruch, sondern das Team der Zukunft
Die gute Nachricht also ist: KI und Empathie schließen sich nicht aus. Sie ergänzen sich. Die eine sorgt für Effizienz, die andere für Menschlichkeit. Der eine Part automatisiert, der andere bindet.
Die Verwaltung der Zukunft ist nicht nur digital – sie ist auch emotional intelligent. Sie nutzt Technologie, ohne sich von ihr dominieren zu lassen. Sie begegnet Menschen nicht nur als Aktenzeichen, sondern als Individuen. Sie investiert nicht nur in Tools – sondern in Kultur.
Wenn es gelingt, beides zu verbinden, kann die Transformation der Verwaltung gelingen. Mit KI UND Empathie. Für die Bürger:innen. Für die Mitarbeitenden. Und für eine öffentliche Verwaltung, die bereit ist für morgen.