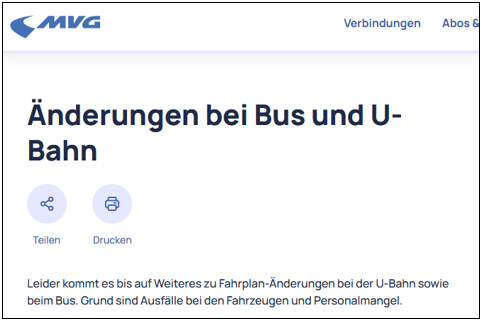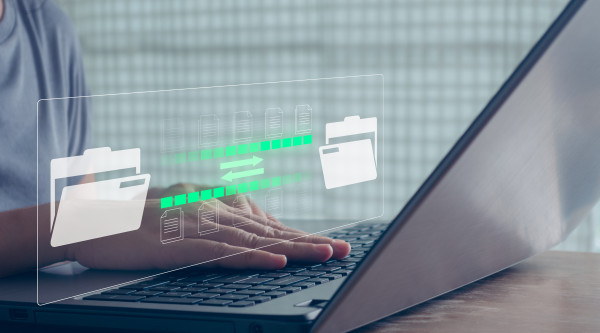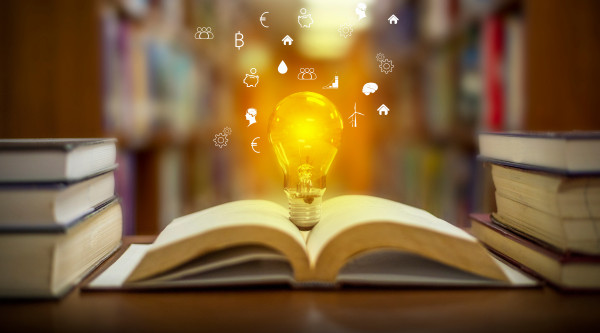Mobilität in München – immer eingeschränkter und teurer?
„Don’t follow the science“, das Credo der Stadtverwaltung?
Die aktuellen Trends der Stadtplanung, von progressiven Kommunalpolitikern gerne aufgegriffen, wollen Mobilität neugestalten. PKWs sollen endlich Raum geben für nichtmotorisierten oder wenigstens elektrounterstützten Verkehr.
„Follow the science“ – aber welcher?
Stadtplanung wie auch -verwaltung sollte auf Zahlen und Fakten basieren, deshalb sind Menschen wie Otto Wagner, der im Fin de siècle Straßen, Bauten und den ÖPNV des kaiserlichen Wiens für eine Drei- bis Viermillionenstadt auslegte, oder Graf István Széchenyi, der den Hochwasserschutz für Budapest um 1830 auf einen Pegel von 10 Metern auslegte, zumindest im Nachhinein als „richtig gelegen“ anerkannt. Besagtem Grafen Széchenyi warf man damals Geldverschwendung vor, aber als 2006 bzw. 2013 erstmalig bei Hochwasser die Neunmetermarke erreicht wurde, war man sehr dankbar für seine Voraussicht.
Von den Vertretern der „autogerechten Stadt“ der 50er- und 60er-Jahre wendet man sich heute mit Gruseln ab. Durch Altstädte geschlagene Autobahnschneisen und durch seelenzerstörende Betonblöcke wirken 70-80 Jahre später wie kollektiver Irrsinn. Allerdings: die Apologeten der Stadtplanung im Gefolge von Le Corbusier hielten die gewachsene europäische Stadt für genauso überholt wie die heutigen Stadtpolitiker den motorisierten Individualverkehr (MIV).
Immer mehr Autos in München zugelassen
Die Bevölkerung der Landeshauptstadt München ist in den letzten 30 Jahren relativ konstant geblieben und steigt nur leicht mit ca. einem ¾ Prozent pro Jahr. Manchmal gibt es sogar leichte Rückgänge, bspw. von 2022 auf 2023 oder von 2016 auf 2017.
Die Bevölkerung wächst zwar nur schwach, aber der Bestand an PKW wächst dafür umso stärker. So zeigt die PKW-Zulassungsstatistik 2011-2024 ein sehr starkes Wachstum. Waren 2011 noch 618.787 PKW in München zugelassen, so waren es 2024 763.673, also über 23 % Steigerung in nur 13 Jahren oder 1,8 % jährlich. Das heißt, der PKW-Bestand wuchs mehr als doppelt so stark wie die Einwohnerschaft. Dieses Wachstum des PKW-Bestandes in München ist konsistent mit dem PKW-Bestand in Deutschland: Dieser stieg von 42,3 Mio. in 2011 auf 49,1 Mio. in 2024, also um 16 % - und somit auch stärker als die Bevölkerung Deutschlands, die von 2011 auf 2024 um nur 4 % wuchs.
Natürlich lassen auch Münchner Firmen ihre deutschlandweit genutzten PKW in München zu – aber das erklärt nicht diesen Anstieg. Alle Autovermieter Deutschlands, inklusive der SIXT AG, haben zusammen einen Bestand von 330.934 PKW per 2024. München hat über eine halbe Million Einpendler, die sicherlich nicht alle mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV kommen, ebenso erhöht die Förderung von e-Autos den Bestand – denn auch ein e-Auto bedarf eines Parkplatzes.
Als Zwischenfazit kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Zahl der zugelassenen PKW pro Kopf ansteigt – in München stärker als im restlichen Bundesgebiet. Dies führt, zumindest nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage, zu einer verstärkten Nachfrage nach Parkplätzen.
Immer weniger (öffentliche) Parkplätze in München
Laut dem aktuellen Koalitionsvertrag zwischen OBM Reiter, der SPD, den Grünen und den Fraktionen Die Grünen – Rosa Liste sowie der Fraktionsgemeinschaft SPD/Volt sollen mindestens 500 Parkplätze jährlich verschwinden.
Zitat S. 16: „Im Bereich des Autoverkehrs werden öffentliche Parkplätze umgewandelt bzw. reduziert (mindestens 500 pro Jahr), das Parkraummanagement ausgebaut, die Stellplatzsatzung mit dem Ziel von weniger Flächenverbrauch reformiert und Quartiersgaragen in Neubaugebieten geschaffen.“
Das bedeutet, dass z. B. für den Nettozuwachs an PKW von 2023 auf 2024 von 2.324 PKW nicht eben zusätzliche 2.324 öffentliche Parkplätze neu geschaffen wurden und werden, sondern im Gegenteil zumindest weitere 500 wegfallen. Damit wird eine Knappheit von 2.824 Parkplätzen produziert.
Sofern öffentliche Parkplätze, auch von der Stadt angebotene kostenpflichtige Garagenplätze, dieses Wachstum nicht ausgleichen, bleibt nur das private Angebot. Dieses ist natürlich kostenpflichtig, und München war bereits 2020 hinter Frankfurt/Main Spitzenreiter bei den maximalen Mieten für einen Stell- bzw. Garagenplatz mit 200 Euro/Monat.
Eine kurze Internetsuche nach Parkplätzen im Bezirk Au-Haidhausen zur Miete ergibt am 11.6.2025 13 Angebote, einen Durchschnittsmietpreis pro Monat von EUR 106,52 und einen Medianpreis von EUR 120,00. Die dort angebotenen fünf Garagenparkplätze zum Kauf rangieren zwischen EUR 9.000,00 und EUR 35.000,00 (in Worten: fünfunddreißigtausend Euro). Was aber sind die angebotenen Alternativen zum MIV?
Mobilitätslösungen in München – Angebote nur für
gesunde, junge Menschen?
Die Webseite der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG grüßt bairisch-jovial mit:
Die dort angeführte Liste an betroffenen Linien ist lang. Aus eigener Erfahrung des Autors sind ganztägige Intervalle in innenstadtnahen Bezirken von 20 Minuten keine Seltenheit, sondern mittlerweile die Normalität.
Somit bleibt an Mobilitätslösungen nur das Fahrrad, der e-Scooter und das eigene Paar Beine übrig. Leider ist die Münchner Bevölkerung überaltert und bei einem Anteil U40 von nur 50,3 % (inklusive Säuglinge und Kleinkinder), hingegen von 35,8 % an Ü50, werden diese angebotenen Alternativen zum ÖPNV keine Lösungen für alle sein. Dazu kommt ein Anteil an 10,2 % der Stadtbevölkerung, die behindert ist, wie die München Statistik 2008 feststellte. Dieser Anteil ist konsistent mit der Statistik des Freistaats Bayern, die für 2019 11,6 % Menschen mit Behinderung, davon 8,6 % Schwerbehinderte ausweist. Dass allerwenigstens für diese Menschen die „Mobilitätslösungen“ Fahrrad, e-Scooter oder selbst laufen keine Lösungen darstellen, wird auch der 2. Bürgermeister von München nicht bestreiten, der im Februar 2025 behauptete „Die umweltfreundlichen Verkehrsmittel boomen in München und machen inzwischen fast 80 Prozent des Gesamtverkehrs aus.“ sowie „Ich hoffe, dass wir in Zukunft weniger aufgeladene Debatten zu verschiedenen Verkehrsarten haben“.
Der Modal Split, auf den er sich vermutlich bezieht, ist tatsächlich bei 76 %. Leider bezieht sich dieser Modal Split auf die Anzahl der Wege, d. h. entgegen der Definition der Eurostat nicht auf zurückgelegte Personenkilometer. Die hier referenzierte Studie der TU Dresden bezieht sich auf Folie 4 auf „Der „Modal Split“ – Anzahl der Wege“, also ein halber Kilometer zu Fuß ist hier gleichwertig wie 25 Kilometer mit dem Auto. Zwei Folien weiter steht dann auch, dass nicht, wie der 2. Bürgermeister behauptete, 80 % des Gesamtverkehrs umweltfreundlich zurückgelegt werden, sondern nur 52 %. Denn Gesamtverkehr bemisst sich in Personenkilometern. Zusätzlich ist anzumerken, dass die TU Dresden hierfür nur 22.300 Haushalte bzw. 40.400 Personen bundesweit, d. h. nicht nur in München, befragte.
Auch der internationale Vergleich der Modal Splits, bei unterschiedlicher Berechnung zumindest als Indikation, hilft in der Einschätzung der Münchner Mobilitätsangebote, insbesondere des ÖPNV-Angebots:
| München | Wien | Budapest | Prag | |
| zu Fuß | 33 % | 30 % | 11 % | 30 % |
| Fahrrad | 21 % | 11 % | 2 % | 1 % |
| ÖPNV | 22 % | 34 % | 45 % | 46 % |
| PKW | 24 % | 25 % | 42 % | 23 % |
|
Preis reguläre Jahreskarte |
684,00 € | 365,00 € | 249,37 € | 147,27 € |
| Preis Senioren Ü65 Jahreskarte | 570,00 € | 235,00 € | gratis | gratis |
| BIP pro Kopf, 2024, bereinigt nach Kaufkraftäquivalent | 72.599 USD | 74.372 USD | 48.600 USD | 59.368 USD |
Diese drei, mit München gut vergleichbaren Städte, weisen einen deutlich, deutlich höheren ÖPNV-Anteil auf. Während in München der sozusagen „alten- und behindertenfreundliche Verkehrsmittelanteil“ (PKW und ÖPNV), also nicht auf eigene Muskelkraft angewiesene Anteil bei 46 % liegt, liegt er in den anderen Städten wesentlich höher. Dass die ÖPNV-Preise in Deutschland viel zu teuer sind und in anderen, auch westeuropäischen Metropolen erheblich billiger, ist seit langem bekannt. Auch quantitativ ist das Münchner Angebot für eine flächen- wie einwohnermäßig um ein Viertel kleinere Stadt schlechter: Während die Wiener Linien 227,4 km Straßenbahnnetz anbieten, sind es in München nur 82 km, bei den Buslinien steht es 892,5 km zu 544 km für Wien. Nur bei der U-Bahn hat München mit 95 km zu 83 km die Nase knapp vorne.
Fazit – was wäre zu tun?
Die Entwicklung in München geht zweifelsohne in zwei Richtungen:
- Verteuerung des Autobesitzes durch Reduktion öffentlicher Parkplätze in Negation des deutlichen Anstieges des absoluten wie des relativen PKW-Besitzes.
- Kein international konkurrenzfähiges Angebot an ÖPNV, deshalb in Summe eine politikgeförderte „Steuerung“ hinein in die Verkehrsmittel Fahrrad und Fußweg, die für Alte und Behinderte, in Summe um die 40 % der Stadtbevölkerung, nicht oder nur eingeschränkt geeignet sind.
Es wäre zu empfehlen, einerseits den Anstieg des PKW-Besitzes und die damit einhergehende Parkraumverknappung nicht zu ignorieren und andererseits Mobilitätsangebote zu schaffen, die auch für nicht junge und nicht gesunde Personen geeignet sind. Hier ist vor allem der ÖPNV noch ausbaufähig, sowohl quantitativ wie auch qualitativ.