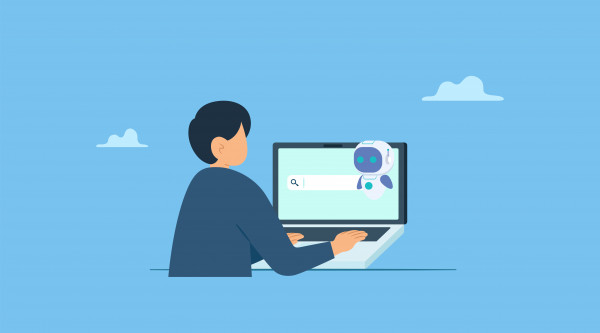Digitale Souveränität braucht klare Führung
Dirk Schrödter gewinnt den Public Leadership Award 2025 in der Kategorie „Individuelles Public Leadership“
Verwaltung der Zukunft: Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Awards für individuelles Public Leadership 2025! Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie?
Dirk Schrödter: Die Auszeichnung hat in mir große Freude ausgelöst. Es ist auch eine große Ehre, dass ich mit dem Award ausgezeichnet wurde, weil sie zeigt, welche Aktivitäten wir hier im Land entfalten. Dass das mit dem Kopf verbunden wird, der das umsetzt und vorantreibt – und dass das wahrgenommen wird –, fand ich beeindruckend. Das ist einem ja selbst nicht so bewusst. Ich bin schon stolz darauf, dass ich sowohl nominiert als auch von der Jury ausgewählt wurde.
VdZ: Leadership ist ein zentrales Thema in der Verwaltungsmodernisierung. Welche Aspekte sind für Sie in der Führung zentral?
Schrödter: Führung bedeutet für mich, Mitarbeitende konsequent zu unterstützen und gleichzeitig klar einzufordern, in welche Richtung sich etwas entwickeln soll. Bei sämtlichen Transformationsprozessen ist es entscheidend, Orientierung zu geben und als Führungskraft eine klare Haltung zu zeigen.
Ich bin überzeugt: Menschen müssen sich neue Systeme und Arbeitsweisen auch selbst erarbeiten – so wie wir intuitiv mit der bislang üblichen Bürosoftware, wie Word oder Excel, umgehen, muss man auch mit anderen Bürosystemen Erfahrungen sammeln. Dafür braucht es Raum, aber auch klare Erwartungshaltungen.
Wichtig ist mir außerdem, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Wer neue Produkte einführt, sollte sie auch selbst nutzen. Es muss eine klare Vision beschrieben und dann auch vorgelebt werden.
VdZ: Schleswig-Holstein verfolgt eine klare Strategie zur digitalen Souveränität. Welche konkreten Wirkungen spüren Sie bereits in der Verwaltungspraxis oder im Zusammenspiel mit IT-Dienstleistern und der Wirtschaft?
Schrödter: Für uns ist digitale Souveränität – also das Lösen aus Abhängigkeiten – ein ganz zentraler Baustein unserer Digitalstrategie. Unsere Haltung ist dabei klar: Digitale Souveränität und die Stärkung des Digitalstandorts sind zwei Seiten ein und derselben Medaille.
Wir können durch die Stärkung digitaler Souveränität und die Einbindung unserer Digitalwirtschaft den Standort Schleswig-Holstein insgesamt stärken. Aber wir schauen bei großen IT-Systemen nicht nur auf unser Land: Mir geht es auch um die Stärkung des Digitalstandorts Deutschland.
Konkret sehen wir, dass Schleswig-Holstein als attraktiver Digitalstandort für Unternehmen wahrgenommen wird. Wir haben unsere Open Source-Szene deutlich belebt, starke Netzwerke aufgebaut und durch unseren strategischen Ansatz neue Entwicklungen angestoßen. Mit Netzwerken meine ich ein Ökosystem aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung, in dem die Rädchen ineinandergreifen, um passgenaue Lösungen für die Verwaltungsdigitalisierung zu schaffen. Das führt dazu, dass unsere Digitalwirtschaft angeregt wird, in diesem Bereich Leistung zu erbringen, Wertschöpfung zu generieren und neue Potenziale für Wachstum zu heben.
Digitale Souveränität und die Stärkung des Digitalstandorts sind zwei Seiten ein und derselben Medaille.
VdZ: Vor welchen wesentlichen Hürden steht Schleswig-Holstein aktuell, und wie gehen Sie als Führungskraft damit um?
Schrödter: Die gute Nachricht zuerst: Digitale Souveränität durch den Einsatz von Open Source-Lösungen ist erreichbar.
Wenn man sich die aktuelle Nachrichtenlage etwa rund um Microsoft und SharePoint anschaut, wird sehr deutlich, wie wichtig es ist, Systeme wirklich zu verstehen – und dass im besten Fall viele Entwicklerinnen und Entwickler Sicherheitslücken entdecken und beheben können. Man darf nicht von einem einzelnen Lösungsanbieter abhängig sein, der sich vielleicht nicht umfassend darum kümmert, ob alles wirklich sicher ist.
Eine große Herausforderung ist aktuell die Anpassung von Fachverfahren. In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Verfahren, in denen Microsoft-Komponenten verbaut sind. Deshalb braucht es jetzt Umstellungen und dazu sind wir mit Herstellern im Gespräch. Wir sagen dabei ganz klar: Wir erwarten Offenheit, offene Schnittstellen, offene Standards. Nur so können wir unsere Systeme andocken. Und wir machen auch deutlich: Wer nicht bereit ist, diesen Weg mit uns zu gehen, von dem trennen wir uns dauerhaft.
Ein zweites Thema ist der Dokumentenaustausch. Auch dazu gibt es bereits Beschlüsse auf Bundesebene – wir setzen hier ebenfalls auf offene Standards und Formate.
Die dritte Herausforderung ist das Change Management innerhalb der Verwaltung, also in den Häusern, Ressorts, Ministerien. Das muss man auf zwei Ebenen angehen: Zum einen mit konkreten Unterstützungsangeboten – Schulungen, Erklärvideos, On-Site-Support, Fortbildungen. Zum anderen aber auch mit einer klaren Haltung: Es gibt nur diesen einen Weg. Und den muss man als Führungskraft auch klar vertreten.
Die gute Nachricht zuerst: Digitale Souveränität durch den Einsatz von Open Source-Lösungen ist erreichbar.
VdZ: Das Land Schleswig-Holstein hat über den DigitalHub.SH ein „Landesprogramm Offene Innovation“ angestoßen. Welche konkreten Ergebnisse oder Kooperationen zeigen bereits, dass hier ein tragfähiges Innovationsökosystem entsteht?
Schrödter: Unser Mindset in Schleswig-Holstein zielt darauf ab, offene Innovationen zu ermöglichen – und zwar auf Basis von Open Source. Genau aus diesem Verständnis heraus ist unser Landesprogramm „Offene Innovation“ entstanden. Wir haben konkrete Digitalisierungsbedarfe identifiziert, zum Beispiel bei kleinen Verwaltungen, gemeinnützigen Vereinen und Stiftungen. Gemeinsam mit der Digitalwirtschaft entwickeln wir dafür Lösungen, die offen gestaltet sind und auch von anderen nachgenutzt werden können.
Ein gutes Beispiel dafür ist unsere eAkte auf Basis von Open Source. Dafür haben wir auch einen digitalen Testraum geschaffen, in dem Dritte die Lösung ausprobieren können. Das Interesse daran ist groß – sowohl bei Bundesbehörden als auch bei anderen Ländern. Ein weiteres Projekt ist startuphafen.sh, ein Tool zur digitalen Unternehmensgründung, das inzwischen an der Westküste in einem Amt im Einsatz ist. Im Prinzip ist das genau die Lösung, die sich die Koalition auf Bundesebene im Koalitionsvertrag vorgenommen hat. Darüber habe ich den Bund auch bereits informiert.
Beide Projekte zeigen die Bandbreite von Verwaltungsdigitalisierung bis hin zu Anwendungen für die Wirtschaft. Wir sehen, dass dieses Landesprogramm nicht nur Lösungen hervorbringt, sondern auch die Art der Zusammenarbeit verändert. Zwischen Verwaltung und Unternehmen, zwischen Projekten, zwischen einzelnen Playern. Wir haben in Schleswig-Holstein eine echte Open Source-Community aufgebaut. Früher waren das oft einzelne „Inseln der Entwicklung“ – heute ist daraus ein tragfähiges Gefüge geworden, ohne dass die Kreativität verloren geht. Dadurch wird das Landesprogramm zum echten Innovationskatalysator.
VdZ: Schleswig-Holstein ist in der Umsetzung seiner Open Source-Strategie Vorreiter in Deutschland. Welche Rückmeldungen erhalten Sie aktuell vom Bund, den anderen Bundesländern und der Wirtschaft?
Schrödter: Ich glaube, in der Bundesregierung ist angekommen, dass digitale Souveränität ganz oben auf der Agenda steht. Nicht zuletzt ist das auch im Koalitionsvertrag verankert – was sicher auch daran liegt, dass ich an der entsprechenden Passage mitgeschrieben habe. Ich nehme beim Bund auf jeden Fall ein wachsendes Bewusstsein für das Thema wahr.
Das gilt auch für Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern. Wir haben dazu bereits einige Beschlüsse gefasst – zum Beispiel in der Ministerpräsidentenkonferenz, der Digitalministerkonferenz und im IT-Planungsrat, etwa zur Stärkung der digitalen Souveränität und zum Lösen aus bestehenden Abhängigkeiten. Im IT-Planungsrat haben wir uns außerdem darauf verständigt, dass offene Dokumentenformate, also das Open Document Format, beim Dokumentenaufbau führend sein sollen und bis 2027 zum Standard werden sollen.
Die Sensibilisierung ist da, auch wenn noch nicht alle Länder so mutig vorangehen wie Schleswig-Holstein. Dafür habe ich Verständnis. Wir haben hier sehr früh angefangen und eine lange Planungsphase hinter uns. Solche Themen bewegt man nicht von heute auf morgen, dafür braucht es einen langen Atem. Wer jetzt erst startet, braucht entsprechenden Vorlauf, politische Gespräche und klare Abstimmungsprozesse. Wir bieten deshalb immer wieder an, unsere Expertise einzubringen und in Kontakt mit dem Bund und mit anderen Ländern, aber auch mit den Kommunen zu treten.
Auch von Seiten der Wirtschaft nehme ich großes Interesse wahr, besonders bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, also den klassischen KMU in Industrie und Dienstleistung. Auch dort besteht der Wunsch, digital souverän zu werden und sich aus Abhängigkeiten zu lösen. Die technologischen und damit wirtschaftlichen Schwierigkeiten betreffen diese Unternehmen genauso wie uns in der Verwaltung.
Mit Blick auf den öffentlichen Sektor erleben wir allerdings: Das internationale Interesse ist größer als das nationale. Die Nachfrage aus europäischen Ländern ist hoch – etwa aus Dänemark, der Schweiz, Österreich oder Frankreich. Auch aus Großbritannien gibt es Anfragen, zuletzt war ein Fernsehteam aus den Niederlanden bei uns. Darüber hinaus berichten auch Medien aus Neuseeland oder Indien über unseren Weg. Wir spüren ein sehr großes internationales Interesse an dem, was wir hier in Schleswig-Holstein aufbauen.
Mit Blick auf den öffentlichen Sektor erleben wir allerdings: Das internationale Interesse ist größer als das nationale.
VdZ: Was motiviert Sie persönlich, die digitale Transformation in Schleswig-Holstein so konsequent voranzutreiben und was ist Ihre langfristige Vision?
Schrödter: Ich bin ein neugieriger Mensch, der bei den Herausforderungen unserer Zeit immer auf technologische Entwicklungen blickt und deren Potenziale gerne vorantreibt. Die Digitalisierung der Verwaltung liegt mir besonders am Herzen. Ich sehe sie als einen ganz wesentlichen Wettbewerbsfaktor für Deutschland.
Natürlich habe ich auch eine Funktion und trage politische Verantwortung. Ich möchte die Verwaltung zu einem Innovationstreiber entwickeln. Mein Antrieb ist, die Bedingungen für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen zu verbessern und damit auch Wachstum und Beschäftigung zu fördern.
Meine langfristige Vision für Schleswig-Holstein sind durchgängig digitale Prozessketten in der Verwaltung. Sie sollen zum Innovationsmotor werden und so den Digitalstandort Schleswig-Holstein stärken und attraktiv machen für Unternehmen sowie für Nachwuchskräfte.