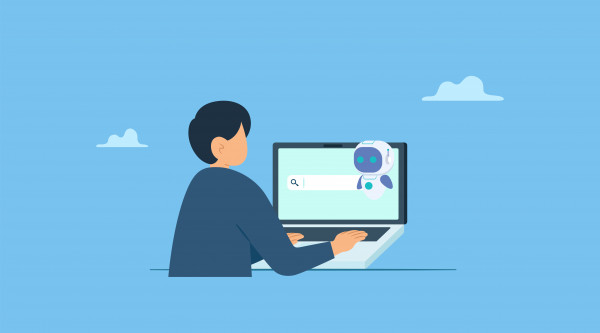Häufig zeigt sich in der Praxis jedoch ein anderes Bild: OKR werden zwar eingeführt, aber selten richtig angewendet. Viele Teams schreiben ambitioniert klingende Objectives auf, ergänzen sie mit vermeintlich konkreten Kennzahlen und betrachten den Prozess als abgeschlossen. Das Ausformulieren von Zielen ersetzt keine echte Steuerung – ohne Klarheit und gelebtes Commitment bleiben sie oft folgenlos.
Vom C-Level zur Umsetzung: Strategische Kaskadierung in der Praxis
Ein oft unterschätzter Aspekt in der OKR-Praxis ist die vertikale Verknüpfung zwischen strategischer Unternehmensführung und operativer Umsetzung. Objectives auf Leitungs-Ebene müssen durchdacht in die Abteilungen und Teams heruntergebrochen werden. Dabei geht es nicht um 1:1-Übertragung, sondern um inhaltliche Übersetzung.
Beispiel aus der Verwaltung:
Ein strategisches Objective wie:
„Die zehn meistgenutzten Bürgerdienste bis Jahresende vollständig digitalisieren – nutzerfreundlich, medienbruchfrei und rund um die Uhr verfügbar“
lässt sich auf Fachbereichsebene beispielsweise wie folgt übersetzen:
- Im IT-Bereich zu:
„Ein zentrales Bürgerportal mit durchgängiger digitaler Antragstellung bis Jahresende bereitstellen.“ - Im Bürgerservice zu:
„Die zehn Top-Dienstleistungen vollständig digital nutzbar machen – ohne Papierformulare und Medienbrüche.“
Diese Kaskadierung verdeutlicht, wie sich strategische Ziele konkret und praxisnah in den Fachbereichen verankern lassen , ohne in operative Beliebigkeit abzurutschen. Eine saubere OKR-Kaskadierung ist essenziell, um aus strategischen Ambitionen verbindliche Umsetzungsschritte abzuleiten und echte Wirksamkeit zu erzielen.
Objectives mit Substanz: Orientierung durch mutige Entscheidungen
Ein Objective ist kein Wunschzettel und kein gut gemeinter Motivationsspruch. Es ist ein strategischer Richtungsgeber, der Klarheit schafft, Fokussierung erzwingt und implizit auch Grenzen setzt. Doch viele Objectives sind zu vage, zu generisch oder zu beliebig. „Wir wollen Innovation vorantreiben“ oder „Wir möchten effizienter arbeiten“ sind Beispiele für wohlklingende, aber wirkungslose Zielsetzungen. Sie lassen offen, was konkret erreicht werden soll, wie ambitioniert das Ziel ist und in welchem Kontext es Bedeutung hat.
Gute Objectives sind mutig, klar und eingebettet in eine übergeordnete Strategie. Sie zwingen zur Entscheidung: Welche Richtung ist uns so wichtig, dass wir dafür andere Initiativen zurückstellen? Welche Wirkung wollen wir wirklich erzielen? Erst durch diese bewusste Fokussierung wird das Objective zu einem echten Führungsinstrument.
Ein prominentes Beispiel ist Googles erstes OKR-Objective aus dem Jahr 1999: „Build the planning model to support our business.“ 1 – ein schlichtes, aber strategisch klares Ziel, das die internen Strukturen absichern sollte, bevor man skaliert. Es war mutig, weil es interne Strukturierung über Wachstum priorisierte – ein kulturelles Statement.
Key Results mit Wirkung: Zwischen Steuerung und Messung
Key Results (KR) sollen die Erreichung eines Objectives messbar machen. Sie geben nicht einfach Zahlen vor, sondern definieren Wirkungskorridore: Daran erkennen wir, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Die Praxis sieht jedoch oft anders aus. Statt wirkungsorientierter Key Results finden sich dort Aktivitätslisten („Informationsveranstaltung durchgeführt“), Aktivismus („20 Workshops mit Fachbereichen organisiert“) oder reine Output-Größen ohne Bezug zum angestrebten Ziel („500 Online-Anträge eingegangen“).
Gute Key Results zeichnen sich durch zwei Merkmale aus: Sie sind (1) ambitioniert, aber realistisch und (2) so formuliert, dass sie weder eine bloße Tätigkeit noch ein zufälliges Ergebnis abbilden, sondern eine nachvollziehbare Zielerreichung beschreiben. Entscheidend ist dabei die Frage: Was ist der Unterschied zwischen „wir haben etwas getan" und „wir haben etwas bewirkt"?
Ein Beispiel: YouTube definierte 2012 als Objective die Verbesserung der mobilen Nutzererfahrung. Die dazugehörigen Key Results lauteten: „Neue App-Version für Android veröffentlichen“ und „Zufriedenheitswert der Nutzer auf mindestens 75 % steigern“. Die Kombination aus konkreten Deliverables und qualitätsbezogenen Outcome-Kriterien zeigt, wie sich Output und Wirkung verknüpfen lassen.
Drei Reflexionsimpulse für Führungskräfte:
- Erzwingt mein Objective eine Entscheidung über Fokus und Verzicht?
- Sind meine Key Results überprüfbar – nicht nur zählbar?
- Ist für das Team steuerbar, was wir erreichen wollen – oder beobachten wir nur?
Input statt Hoffnung: Steuerbare Metriken für echten Fortschritt
Ein weit verbreiteter Irrtum in der OKR-Praxis ist die Überbetonung von Output-Metriken. Nutzungsquoten von Portalen, Bürgerzufriedenheit oder Antragszahlen sind wichtige Ziele – aber sie sind Ergebnisse, keine Steuerungshebel. Teams können sie beobachten, aber nur bedingt steuern. Wenn Key Results ausschließlich auf solche Outputs abzielen, führt das zu Frustration: Man liefert gute Arbeit, aber die Metrik bewegt sich nicht. Oder sie verbessert sich, ohne dass man weiß, warum.
Deshalb brauchen wir Input-Metriken: messbare, beobachtbare Aktivitäten, die plausibel zur Zielerreichung beitragen.
Input-KR können z. B. sein:
- „Monatlich zwei themenspezifische Workshops mit Fachbereichen zur Umsetzung des OZG durchführen“
- „Bis Quartalsende zehn strukturierte Nutzerinterviews mit Bürger:innen zur Bedienbarkeit des neuen Online-Portals führen, um Verbesserungspotenziale für das UI/UX zu identifizieren“
- „Zwei öffentliche Dialogveranstaltungen mit Bürger:innen zur geplanten Verwaltungsreform bis Quartalsende durchführen – mit je mindestens 50 Teilnehmenden und dokumentierter Ergebnisprotokollierung“
Entscheidend dabei ist, dass die Aktivitäten nur dann echte Hebel darstellen, wenn sie sinnvoll mit dem zugrunde liegenden Ziel verknüpft sind und nicht als Selbstzweck durchgeführt werden. Nur dann tragen sie gezielt zur Zielerreichung bei und unterscheiden sich deutlich von bloßem Aktionismus.
Diese Art von Key Results ist kein Aktionismus, sondern ein gezielter Hebel zur Zielerreichung – vorausgesetzt, der Input steht in einem nachvollziehbaren Wirkzusammenhang mit dem angestrebten Outcome. Die Qualität liegt also nicht in der Aktivität an sich, sondern in ihrer Relevanz für das Ziel. Genau darin unterscheiden sich gute Input-Metriken von bloßem Aktionismus.
Die Kunst liegt in der Balance: Ein gutes OKR-Set kombiniert steuerbare Inputs mit wirkungsorientierten Outputs und verknüpft beides logisch mit dem übergeordneten Ziel.
Die Balance von Input und Output zeigt auch ein Beispiel aus Measure What Matters von John Doerr: Die Non-Profit-Organisation ONE (Bonos Initiative gegen extreme Armut) arbeitete mit folgendem OKR-Set.
- Objective: „Drive global support for aid transparency“
- Output-KR: „Secure commitment from 5 G8 leaders“
- Input-KR: „Conduct 30 high-level advocacy meetings with government officials“
Diese Kombination zeigt klar: Fortschritt wird nicht nur beobachtet, sondern aktiv gestaltet. Das eine misst Wirkung, das andere steuert dahin – genau diese Verbindung macht OKR wirksam.
OKR in der Führungskultur: Zwischen Haltung und Routine
Viele Einrichtungen scheitern nicht an den OKR selbst, sondern an ihrer Integration in die Führungskultur. OKR werden einmal pro Quartal formuliert, ins Tool eingetragen und danach ignoriert oder im Review oberflächlich „abgerechnet“. Das verfehlt ihr Potenzial vollkommen. OKR sind kein Reporting-Werkzeug, sondern ein Kommunikations- und Führungsinstrument. Sie sollen Gespräche anstoßen, Reflexion fördern und Eigenverantwortung unterstützen.
Dazu gehören drei Voraussetzungen:
- Führung im Prozess, also die Bereitschaft, Konflikte in der Priorisierung auszutragen.
- Transparenz und Vertrauen, damit Teams mutig mit OKR arbeiten, ohne Angst vor Bestrafung.
- Regelmäßiger Dialog: OKR müssen Teil der wöchentlichen Teamroutinen werden – nicht nur des Quartalsberichts.
Christina Wodtke beschreibt in Radical Focus (2016), wie OKR erst durch konsequente Check-ins, offene Kommunikation und klare Verantwortlichkeiten ihre volle Wirkung entfalten. Die Führungskraft tritt dabei nicht als Kontrolleur, sondern als Coach auf – eine Haltung, die OKR erst wirksam macht.
Teams, die agil arbeiten, sollten OKR außerdem in ihre Sprint- oder Monats-Retrospektiven integrieren. Die Frage „Wie haben unsere OKR unsere Entscheidungen beeinflusst?“ schafft Bewusstsein für Relevanz und Qualität – und macht Fortschritt sichtbar.
Fazit: OKR ermöglichen Führung – wenn sie richtig gelebt werden
Wer OKR als Führungsinstrument einsetzt, führt nicht über Ziele, sondern über Klarheit. Gute OKR sind weniger ein System zur Leistungsbewertung als ein System zur Fokussetzung und Wirkungsmessung. Sie funktionieren nicht, wenn man sie lediglich „nutzt" – ihre Wirkung entfalten sie erst, wenn man sie lebt.
John Doerr betont, dass OKR kein „What are we doing?“ beantworten sollen – die entscheidende Frage lautet vielmehr: „What really matters?“
Christina Wodtke fordert: „If your Objective doesn’t make you a little nervous, it’s not ambitious enough.“
Und Felipe Castro bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: „Don’t implement OKRs. Start leading with OKRs.“
Alle drei Perspektiven führen zur gleichen Erkenntnis:
OKR wirken nicht durch das Aufschreiben von Zielen. Maßgeblich sind die Führungsentscheidungen, die damit verbunden sind. Sie entfalten ihre Kraft nur dann, wenn Führungskräfte sie als integralen Bestandteil ihres Führungsverständnisses begreifen. Nicht das Tool verändert die Organisation; verändert wird sie durch die Haltung, mit der es genutzt wird.
Das bedeutet:
- Objectives, die Richtung geben.
- Key Results, die Wirkung messbar machen.
- Und Führung, die Mut zur Entscheidung zeigt.
Wer das verinnerlicht, nutzt OKR nicht als Methode – sondern als Haltung. Und genau das unterscheidet Zieladministration von echter Führung.
Quellen:
-
[1] https://www.workpath.com/en/magazine/okr-google
-
John Doerr: Measure What Matters – OKRs: The Simple Idea That Drives 10x Growth. Portfolio Penguin, 2018.
-
Christina Wodtke: Radical Focus – Achieving Your Most Important Goals with Objectives and Key Results. Cucina Media, 2016.
-
Felipe Castro: Start Leading With OKRs, Blogartikel, 2017. Verfügbar unter: www.felipecastro.com