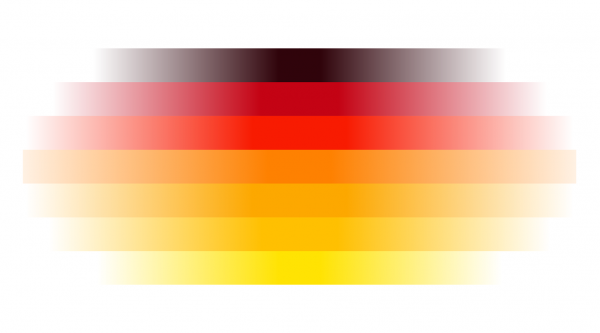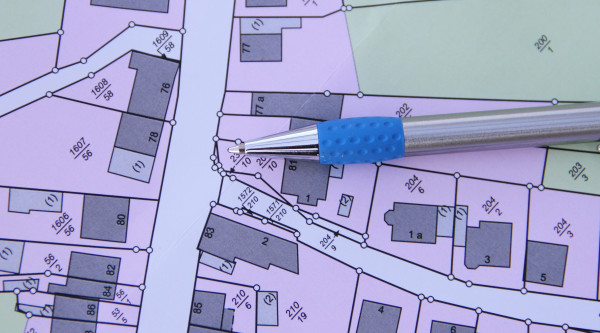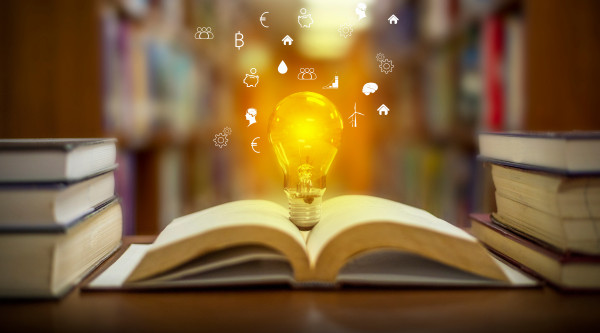Strategische Allianzen für die digitale Verwaltung
Wie öffentliche IT-Dienstleister und private Unternehmen gemeinsam mehr erreichen können
Die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung hat in den letzten Jahren spürbar Fahrt aufgenommen. Verwaltungsportale, Online-Anträge, digitale Fachverfahren – viele Projekte wurden angestoßen, einige erfolgreich umgesetzt. Die Pandemie hat dabei als Beschleuniger gewirkt, politische Priorisierungen wie das Onlinezugangsgesetz (OZG 2.0) haben das Thema fest auf der Agenda der Bundesregierung verankert. Damit ist der Weg zur digitalen Verwaltung allerdings nicht zu Ende. Im Gegenteil: Die Herausforderungen wachsen, weil Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen zunehmend digitale Services erwarten, die intuitiv, schnell und sicher funktionieren.
Um dieser Dynamik gerecht zu werden, braucht es neben politischen Weichenstellungen und technischen Lösungen vor allem eines: funktionierende und zukunftsgerichtete Kooperationen zwischen öffentlichen IT-Dienstleistern und privatwirtschaftlichen Technologieanbietern. Doch wie gelingt eine solche Zusammenarbeit auf Augenhöhe? Drei Voraussetzungen sind dafür entscheidend.
1. Vergaberecht neu denken und flexibel nutzen
Der erste Schlüssel für erfolgreiche Kooperationen liegt im Vergaberecht. Dessen gegenwärtige Umsetzung wird von vielen Beteiligten als starr und bürokratisch wahrgenommen: Ausschreibungszyklen sind lang, tendenziell wachsende Losgrößen schließen kleinere, häufig innovative Akteure faktisch aus. Gleichzeitig sind iterative oder agile Vorgehensweisen vielfach nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das hat zur Folge, dass potenziell vielversprechende Kooperationen bereits vor dem Start scheitern.
Doch das Vergaberecht ist kein grundsätzliches Hindernis. Tatsächlich bietet es bereits heute verschiedene Spielräume:
- Die in Bund und Ländern eingerichteten E-Vergabe-Plattformen und die Pflicht zur Annahme elektronischer Rechnungen bei öffentlichen Auftraggebern sind erste positive Entwicklungen.
- Ebenso begrüßenswert sind Maßnahmen für eine sozial und umweltbezogene nachhaltige Beschaffung.
- Anfang 2025 wurden die Wertgrenzen für Direktaufträge durch Vergabestellen der öffentlichen Verwaltung deutlich erhöht. Die Verwaltung erhält damit einen schnelleren Zugriff auf externe Leistungen.
- Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur automatisierten Vorbereitung öffentlicher Ausschreibungen, zum Beispiel mittels GovRadar in Nordrhein-Westfalen, wird dazu beitragen, Ausschreibungsprozesse deutlich zu beschleunigen.
- Im Rahmen der Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen gibt es erste Verprobungen iterativer oder agiler Vorgehensmodelle, wie z.B. im EVB-IT SPRINT des ITZBund.
Entscheidend ist allerdings auch, dass öffentliche Auftraggeber diese Optionen flexibel nutzen und die notwendigen juristischen und organisatorischen Kompetenzen aufbauen. Besondere Hoffnung setzt die Branche auf das neue Vergabebeschleunigungsgesetz, welches sich im Zuge der Umsetzung des Koalitionsvertrags aktuell in Abstimmung befindet. Wenn es gelingt, diese Reform mutig und praxisnah umzusetzen und dabei auch iterative oder agile Modelle der Zusammenarbeit zu verankern, könnten künftig deutlich mehr Projekte in partnerschaftlicher Zusammenarbeit realisiert werden.
2. Neue Kooperationsformen statt starrer PPP-Modelle
Die zweite Voraussetzung betrifft die Art der Zusammenarbeit selbst. Klassische Public Private Partnerships (PPP) haben sich in der digitalen Verwaltung bislang nur begrenzt bewährt, sie machen derzeit gerade einmal vier Prozent am gesamten Investitionsvolumen der öffentlichen Hand aus. Der Grund: Sie sind häufig zu unflexibel und damit zu wenig auf die dynamischen Anforderungen digitaler Projekte zugeschnitten. In Anbetracht bestehender Herausforderungen der Digitalisierung sollten jedoch insbesondere im Bereich der IT-Infrastrukturen das Modell der PPP und deren Chancen für Innovation und Effizienz neu bewertet werden.
Erfolgversprechender sind jedoch Partnerschaften, die auf Agilität, Co-Kreation und gemeinsamen Wertschöpfungsmodellen basieren. Hier geht es nicht nur darum, ein Produkt oder eine Leistung zu beschaffen bzw. bereitzustellen. Vielmehr zielen die neuen Kooperationen darauf ab, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten – auf Augenhöhe und mit dem Ziel, die digitale Leistungsfähigkeit der Verwaltung nachhaltig zu verbessern.
Ein Beispiel dafür ist der GovTech Campus Deutschland: ein Innovations- und Entwicklungsraum für digitale Verwaltungstechnologien, der Bund, Länder und Kommunen sowie Tech-Akteure zusammenbringt. Der Campus bietet nicht nur die räumlichen Voraussetzungen für eine kreative Zusammenarbeit, er schafft auch einen transparenten und vertrauensvollen Rahmen, in dem Unternehmen und Verwaltung gemeinsam Innovationen vorantreiben können. Digitallabore auf Landesebene und Reallabore, in denen innovative Technologien gemeinsam und mit klaren Rollen- und Aufgabenverteilungen erprobt werden, sind weitere Beispiele für zukunftsfähige Partnerschaften.
Für IT-Unternehmen bedeutet diese neue Kooperationskultur einen Perspektivwechsel: Statt primär auf ausgeschriebene Aufträge zu reagieren, sind sie zunehmend gefordert, sich frühzeitig und aktiv in Innovationsprozesse einzubringen: mit Ideen, mit technologischer Expertise und mit dem Verständnis für verwaltungsspezifische Herausforderungen. Erfolgreiche Partnerschaften entstehen dort, wo Unternehmen nicht nur als Lieferanten, sondern als Mitentwickler und Impulsgeber agieren.
3. Standardisierung und Interoperabilität fördern
Die dritte Voraussetzung ist technischer, aber nicht minder entscheidend: Standardisierung und Interoperabilität. Ohne offene Schnittstellen, einheitliche Datenmodelle und gemeinsame Architekturprinzipien können weder Behörden effizient zusammenarbeiten noch externe Partner sinnvoll eingebunden werden.
Viele Fortschritte in der Digitalisierung von Verwaltungen scheitern schlichtweg an der mangelnden Kompatibilität von Systemen. Deshalb braucht es einen stärkeren Fokus auf digitale Souveränität und eine Ausweitung des Begriffes „Wechselfähigkeit“ auf die Kooperation zwischen öffentlichen IT-Dienstleistern und privatwirtschaftlichen IT-Unternehmen: IT-Lösungen sollten so konzipiert sein, dass die Datenhoheit weiterhin in den Händen der Nutzer liegt, Abhängigkeiten von einzelnen Technologieanbietern ausgeschlossen werden und die Kombination mit anderen Systemen möglich ist.
In der Realität erschweren heterogene IT-Landschaften mit unzureichender Standardisierung die effiziente Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren und die Skalierbarkeit gemeinsamer Lösungen. Das hindert insbesondere kleine IT-Unternehmen und Start-ups daran, ihre Leistungsangebote in eine Kooperation mit öffentlichen IT-Dienstleistern einzubringen. Hier sind Bund, Länder und Kommunen gleichermaßen gefordert, sich für mehr Transparenz, Wahlfreiheit und Wettbewerb auszusprechen.
Vor dem skizzierten Hintergrund fördert das Ende 2022 gegründete Zentrum für digitale Souveränität (ZenDIS) die Verfügbarkeit und Nutzung skalierbarer Open-Source-Softwarelösungen in der öffentlichen Verwaltung und stellt mit OpenCode eine Plattform für die Kooperation in diesem Bereich zur Verfügung.
Auch die Entwicklung der Föderalen IT-Architekturrichtlinie war ein wichtiger Schritt zur Standardisierung. Mit dem so genannten Deutschland-Stack soll nun ein standardisierter Rahmen für KI, Cloud und Basiskomponenten geschaffen werden. Statt digitaler Insellösungen in verschiedenen Bundesländern will der Bund dazu ein System etablieren, dass interoperabel, sicher und anschlussfähig an europäische Standards ist. Mit dem Deutschland-Stack werden Abhängigkeiten zu einzelnen Anbietern reduziert und Kooperationsmöglichkeiten für öffentliche IT-Dienstleister und IT-Unternehmen verbessert.
Fazit: Strategische Kooperationen sind der Schlüssel zur digitalen Verwaltung
Die digitale Transformation der Verwaltung ist ein langfristiger, komplexer und dynamischer Prozess. Keine Organisation kann diese Aufgabe alleine stemmen. Was es braucht, sind tragfähige strategische Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und privaten IT-Sektor. Kooperation ist dabei kein Selbstzweck, sondern eine Grundvoraussetzung dafür, dass digitale Lösungen schnell, sicher und nutzerzentriert in die Fläche gebracht werden können.
Dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen: ein modernes Vergaberecht, flexible Kooperationsmodelle und ein hohes Maß an technischer Interoperabilität. Gelingt dies, kann Deutschland seine digitale Verwaltung zukunftssicher aufstellen – zum Nutzen von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und der gesamten Gesellschaft.