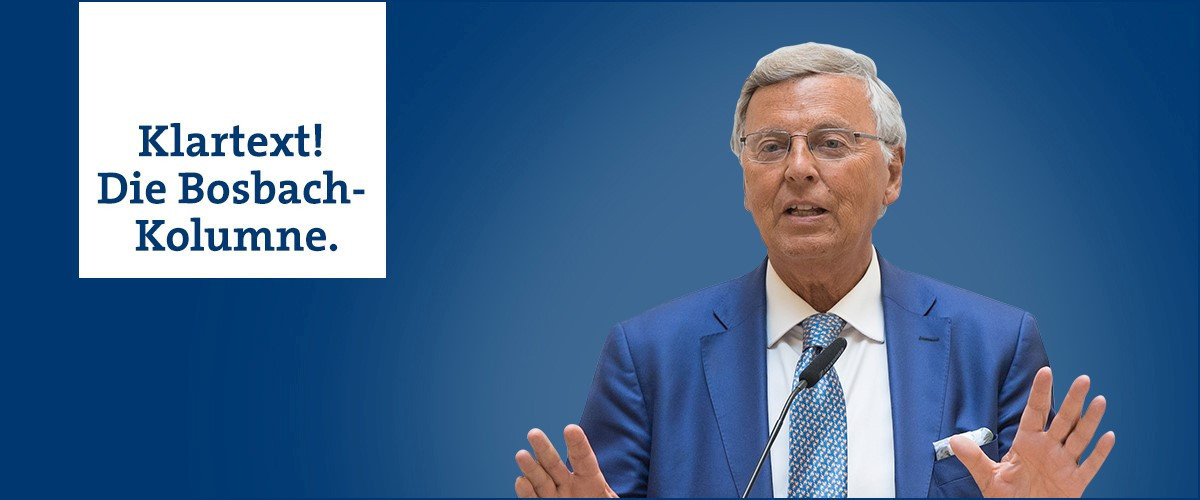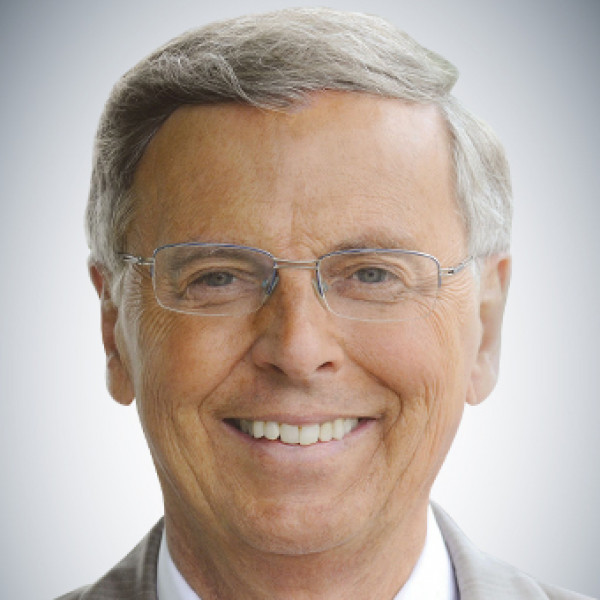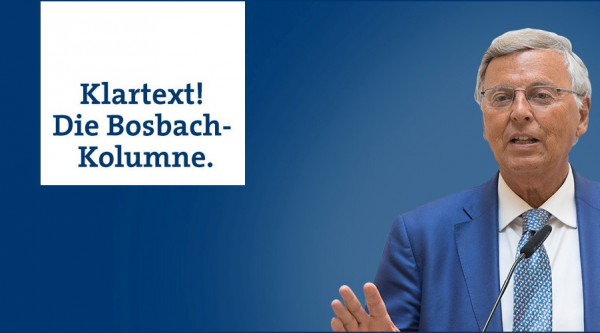Die AfD als „Rechtsextremistischer Verdachtsfall“ – und jetzt?
Welche Konsequenzen ergeben sich aus der nunmehr rechtskräftigen Entscheidung des OVG Münster – rechtlich und politisch?
Die Themen Wirtschaftsspionage, Industrie- und Rüstungsspionage bzw. Proliferation können wir im obigen Kontext getrost beiseitelegen. Rein rechtlich ist die Stoßrichtung derartiger Bestrebungen nicht von Bedeutung, die Angriffe können von Links- oder Rechtsaußen, vom religiösen Extremismus oder gar dem Bereich Terrorismus ausgehen. § 8 des Gesetzes regelt dann die Befugnisse des Bundesamtes zur Erfüllung seiner Aufgaben, bezieht aber auch datenschutzrechtliche Aspekte ein, Stichwort „Schutz personenbezogener Daten“. Allerdings hat das Amt keine polizeilichen Befugnisse, hier gilt das historisch begründete Trennungsgebot, was allerdings vielfach auch verfassungsrechtlich aus Art. 73 Nr. 10 i.V.m Art. 87 GG hergeleitet wird.
Je nach Erkenntnisgewinnung (über verfassungsfeindliche Aktivitäten) sind verschiedene Stadien zu unterscheiden und demnach auch der Mitteleinsatz der Behörde.
Die erste Stufe wird als „Prüffall“ bezeichnet. Hier geht es um die Sammlung und Auswertung von relevanten Informationen durch konkrete Aktivitäten, die aber nicht kämpferisch-aggressiv oder illegal sein müssen. Das Ergebnis derartiger Prüfungen kann in der Einstufung als „Verdachtsfall“ münden – im Falle der AfD als „rechtsextremistischer Verdachtsfall“. Spätestens ab diesem Moment können zur Gewinnung weiterer Erkenntnisse und zur Abwehr von Gefahren für die demokratische Ordnung (auch) nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt werden: V-Leute, Observation, Bild- und Tonaufzeichnungen.
Gerade dies dürfte mit ein Grund dafür gewesen sein, dass sich die AfD mit allen juristisch möglichen Mitteln gegen diese Einstufung gewährt hat. Zunächst vor dem VG Köln, dann – im Berufungsverfahren – vor dem OVG Münster, in beiden Fällen ohne Erfolg. Da das OVG eine Revision nicht zugelassen hat, wurde seitens der AfD eine Nichtzulassungsbeschwerde beim BVerwG eingereicht, auch hier erfolglos. Damit ist der Rechtsweg für die AfD ausgeschöpft, es bleibt also bei der Entscheidung des OVG Münster, die nunmehr Rechtskraft erlangt. Mit allen sich daraus ergebenden Folgen und damit erweiterten Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung. Mit welchen Ergebnissen lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit Bestimmtheit sagen.
Und was bedeutet das für einen etwaigen Antrag auf Verbot der AfD vor dem BVerfG? Sicherlich wird die Entscheidung des BVerwG den Befürwortern Rückenwind geben, sicher ist aber auch, dass die Gleichung „Rechtsextremistischer Verdachtsfall = Parteiverbot sicher“ verfassungsrechtlich ziemlich verwegen ist. Gerade aus den Karlsruher Entscheidungen in den beiden NPD-Verbotsverfahren wissen wir, dass die Hürden für ein Verbot hoch sind, auf jeden Fall höher als bei der Einstufung als „Verdachtsfall“.
Der Autor, Wolfgang Bosbach, ist Kongresspräsident des Berliner Kongresses für Wehrhafte Demokratie. Von 1994 bis 2017 war er Mitglied des Deutschen Bundestages und dort unter anderem von 2000 bis 2009 stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für den Bereich Innen- und Rechtspolitik und von 2009 bis 2015 Vorsitzender des parlamentarischen Innenausschusses.
Der 8. Berliner Kongress Wehrhafte Demokratie - Gesellschaftlicher Dialog für Innere Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und Zusammenhalt findet vom 29. bis 30. Juni 2026 im Hotel de Rome in Berlin statt.