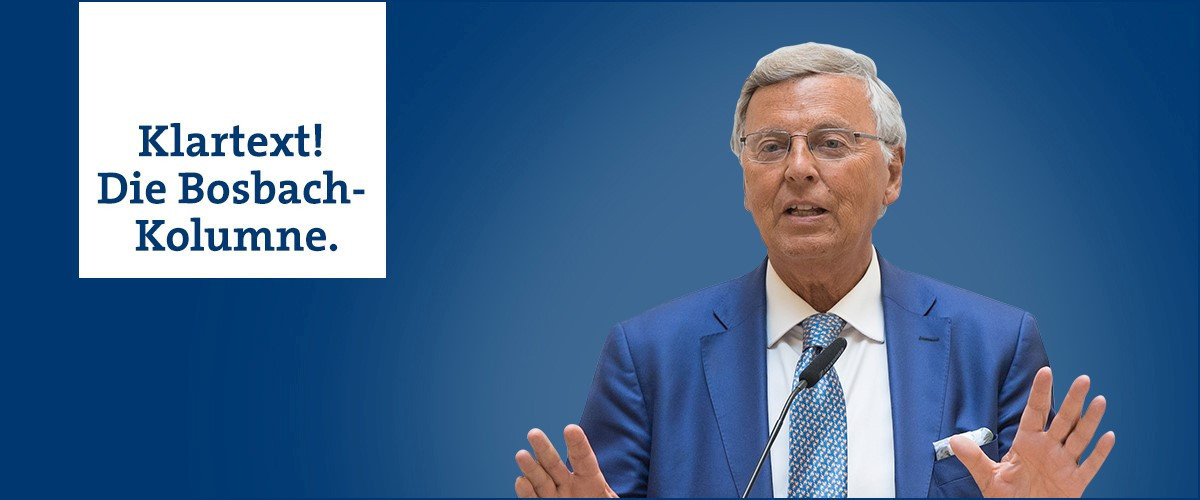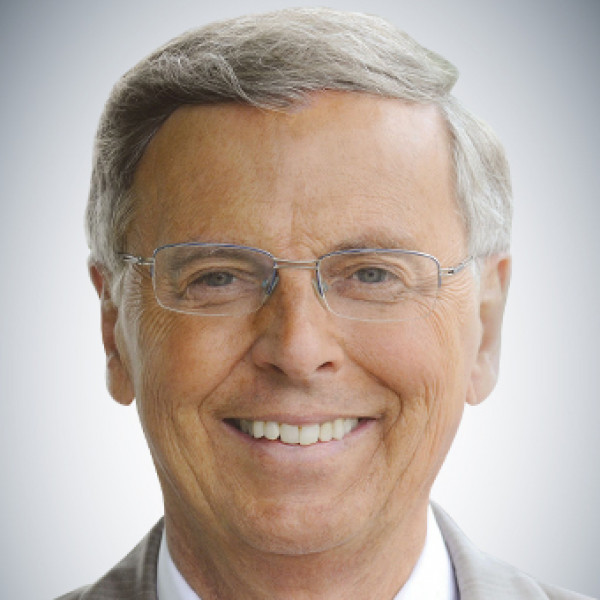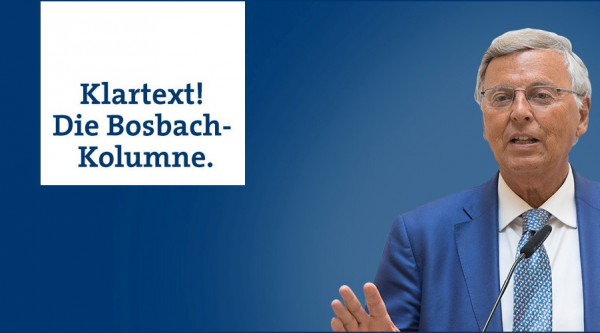Können wir für die moderne Polizeiarbeit von der Antike lernen?
Wie der „Staatstrojaner“ die Gemüter erhitzt und die Justiz beschäftigt.
Über die Attraktionen der Stadt ist nur wenig bekannt. Am bekanntesten dürfte das „Trojanische Pferd“ sein, nicht aus Fleisch und Blut, sondern zusammengezimmert aus grobem Holz. Ein wahres Monument. So groß, dass in dessen Bauch viele griechische Soldaten Platz fanden, die nach der Platzierung des Pferdes in der Innenstadt von Troja, nachts ihr Versteck verließen, dem außen lauernden Heer die Stadttore öffneten und ihren Gastgebern das Leben zur Hölle machten.
Diese Kriegslist ist legendär und der Begriff „Trojaner“ fand nicht nur Eingang in die Geschichtsbücher, sondern auch in den allgemeinen Sprachgebrauch. Namentlich dann, wenn harmlos erscheinende Dinge zu anderen Zwecken eingesetzt werden sollen. Hierzu gehört auch eine Schadsoftware, mit deren Hilfe sich Ermittlungsbehörden Zugang zu Computersystemen verschaffen wollen, um dort schon gespeicherte oder noch zu speichernde Inhalte zur Gefahrenabwehr und/oder Strafverfolgung abgreifen zu können. An dieser Stelle soll niemand auf falsche Gedanken gebracht werden, daher sei nur allgemein auf gefälschte E-Mails oder Downloadangebote hingewiesen.
Solange über den Einsatz dieser technischen Vorgehensweise zur Verhinderung und/oder Aufklärung schwerer und schwerster Straftaten diskutiert wird, solange verlaufen diese Debatten hitzig und die Argumente schwanken zwischen „Angriff auf die Bürgerrechte“ einerseits und „unverzichtbares Instrument zur Stärkung der Inneren Sicherheit“ andererseits hin und her. Und da alle Eingriffsbefugnisse der Sicherheitsbehörden einer sicheren Rechtsgrundlage bedürfen, ist es kein Wunder, dass auf jede neue Norm eine neue Klage folgt.
So musste sich das BVerfGE jüngst sowohl über den § 100a Absatz I Satz 2 StPO beugen, als auch über die einschlägigen Regelungen im PolG NRW. Das PolG NRW hielt der verfassungsrechtlichen Überprüfung komplett stand, bei der StPO befand es jedoch, dass eine Einschränkung bei den Katalogtaten zu erfolgen habe, außerdem sei dem sogenannten Zitiergebot nicht hinreichend Rechnung getragen worden.
Beachtlich ist, dass diese Rechtsprechung allenfalls in Fachkreisen auf Interesse stieß, ansonsten war das neue Album von Taylor Swift wohl wichtiger. Wie wäre es wohl gewesen, wenn Karlsruhe die Normen als verfassungswidrig verworfen hätte? Ob es daran liegt, dass die hier angegriffenen Rechte nur sehr selten zur praktischen Anwendung kommen? 2023 gab es in ganz Deutschland (!) nur 104 richterliche Anordnungen zur Quellen-TKÜ, nur 26 x wurde eine Online-Durchsuchung richterlich angeordnet – und nur 6 x tatsächlich durchgeführt.
Wie man es auch dreht auch wendet, jede Zahl scheint den Kritikern irgendwie Recht zu geben: Werden neue Befugnisse zu häufig genutzt, dann gilt das als Beweis dafür, dass ein übergriffiger Staat die Bürgerrechte schleift. Kommen sie nur sehr sparsam zum Einsatz, dann geht die Kritik dahin, dass diese Mittel offensichtlich gar nicht benötigt werden.
Jeder Politiker kennt das Problem: Entscheide so – oder entscheide anders. Kritik gibt es so oder so.
Der Autor, Wolfgang Bosbach, ist Kongresspräsident des Berliner Kongresses für Wehrhafte Demokratie. Von 1994 bis 2017 war er Mitglied des Deutschen Bundestages und dort unter anderem von 2000 bis 2009 stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für den Bereich Innen- und Rechtspolitik und von 2009 bis 2015 Vorsitzender des parlamentarischen Innenausschusses.
Der 8. Berliner Kongress Wehrhafte Demokratie - Gesellschaftlicher Dialog für Innere Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und Zusammenhalt findet vom 29. bis 30. Juni 2026 im Kongressbereich des Hotel de Rome in Berlin statt.