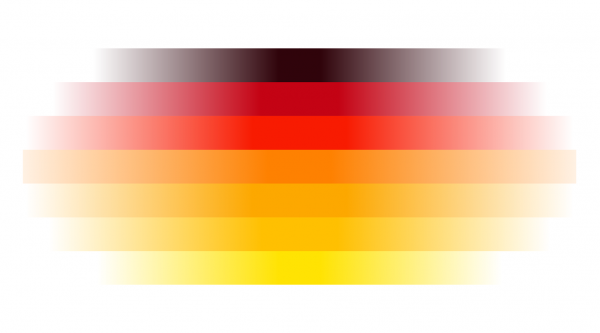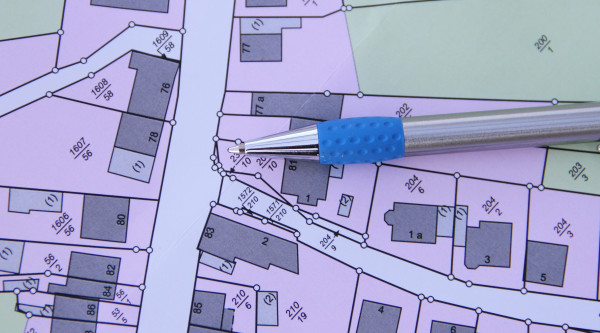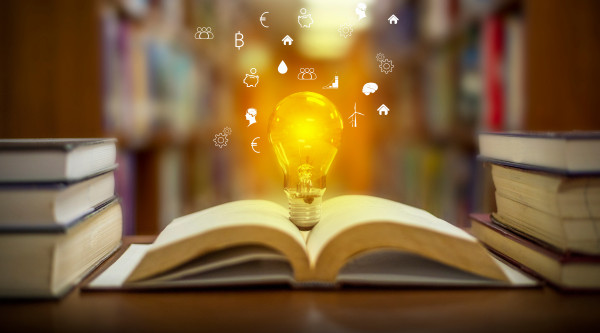„Digitalisierung ist kein Selbstzweck – sie muss den öffentlichen Dienst handlungsfähiger machen“
Interview mit Prof. Dr. Henning Lühr, Hochschule Bremen
Verwaltung der Zukunft: Herr Prof. Dr. Lühr, wie bewerten Sie den aktuellen Stand der Digitalisierung im öffentlichen Dienst?
Prof. Dr. Lühr: Wir haben in den letzten Jahren einen deutlichen Fortschritt gesehen – getrieben durch das Onlinezugangsgesetz, die Verwaltungsdigitalisierung auf Bundes- und Länderebene und nicht zuletzt durch den Schub in der Corona-Pandemie. Dennoch ist der öffentliche Dienst insgesamt noch zu sehr von Pilotprojekten, Insellösungen und unzureichend verknüpften IT-Strukturen geprägt. Die digitale Reife ist je nach Verwaltungsebene sehr unterschiedlich. Während einzelne Kommunen oder Fachverwaltungen beachtliche Lösungen entwickelt haben, fehlt häufig eine durchgängige Nutzerorientierung und Standardisierung.
Wir brauchen eine konsequentere strategische Steuerung, klare Prioritäten und vor allem verbindliche Umsetzungsfristen. Digitalisierung darf nicht mehr als „Projekt“ verstanden werden, sondern als auf Dauer angelegter Transformationsprozess, der Ressourcen, Führungskompetenz und einen Kulturwandel erfordert.
VdZ: Inwiefern können Digitalisierung und der Einsatz von KI die Strukturen und Machtverhältnisse im öffentlichen Sektor verändern?
Lühr: Digitale Technologien verändern nicht nur Prozesse, sondern auch Entscheidungslogiken. Künstliche Intelligenz kann Verwaltungsentscheidungen vorbereiten, Datenmengen auswerten oder Prognosen erstellen, die bislang in diesem Umfang nicht möglich waren. Das verschiebt Verantwortung: weg von individuellen Ermessensentscheidungen hin zu datenbasierten Handlungsvorschlägen. Dadurch wird Transparenz einerseits gestärkt, andererseits steigt die Gefahr einer „Black Box“-Verwaltung, wenn Algorithmen nicht nachvollziehbar sind.
Machtverhältnisse verschieben sich zudem zwischen Verwaltungsebenen: Wer über Daten und deren Analysekompetenz verfügt, gewinnt Einfluss. Deshalb ist es entscheidend, KI-Systeme nicht nur technisch, sondern auch rechtlich und ethisch einzubetten, klare Verantwortlichkeiten zu definieren und die Beschäftigten aktiv einzubeziehen.
VdZ: Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie in der zunehmenden Individualisierung von Arbeitsverhältnissen, etwa durch flexible Arbeitszeiten oder mobiles Arbeiten?
Lühr: Flexibilisierung ist eine große Chance, um den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber attraktiver zu machen und Fachkräfte zu halten. Mobile Arbeit ermöglicht eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und kann die Produktivität steigern. Gleichzeitig ist sie ein Katalysator für eine ergebnisorientierte Führungskultur – weg von Präsenzpflichten hin zu Zielvereinbarungen.
Die Herausforderung besteht darin, die Balance zwischen individueller Freiheit und kollektiver Leistungsfähigkeit zu halten. Das setzt Vertrauen voraus, aber auch klare Regelungen zu Erreichbarkeit, Datenschutz und Arbeitsschutz.
Außerdem dürfen wir nicht vergessen: Nicht alle Tätigkeiten im öffentlichen Dienst lassen sich mobil erledigen. Hier braucht es faire Lösungen, um Spaltungen innerhalb der Belegschaft zu vermeiden.
VdZ: Wie muss sich die betriebliche Mitbestimmung weiterentwickeln, um digitale Transformationen aktiv mitgestalten zu können?
Lühr: Personalräte und Gewerkschaften stehen vor der Aufgabe, nicht nur auf Veränderungen zu reagieren, sondern sie proaktiv mitzugestalten. Das erfordert digitale Kompetenz in den Gremien selbst – von Datenschutz über Prozessdigitalisierung bis hin zu KI-Anwendungen. Mitbestimmung sollte früher einsetzen, idealerweise schon in der Konzeptionsphase von Digitalisierungsprojekten. Außerdem sind neue Beteiligungsformate sinnvoll, etwa agile Projektbeteiligung oder digitale Konsultationen, um schneller und flexibler auf Entwicklungen zu reagieren.
Die gesetzliche Grundlage der Personalvertretung ist in vielen Bereichen noch auf analoge Arbeitswelten ausgerichtet. Hier wäre eine Modernisierung notwendig, um Mitbestimmung auch in digitalen Prozessen wirksam zu verankern. Mitbestimmung muss zu einer interessenausgleichenden, konsensorientierten Gestaltung der künftigen Arbeitswelt weiterentwickelt werden.
VdZ: Inwiefern ist die klassische Struktur der Arbeitsbeziehungen im öffentlichen Dienst noch geeignet, um die gestiegenen Anforderungen an den Staat in Krisensituationen zu bewältigen?
Lühr: Krisen wie die Pandemie, Naturkatastrophen oder sicherheitspolitische Bedrohungen zeigen, dass der öffentliche Dienst extrem belastbar ist – aber auch, dass starre Strukturen schnell an ihre Grenzen stoßen. Das duale System aus Tarifbeschäftigten und Beamten hat seine Vorteile, zum Beispiel in der Gewährleistung von Kontinuität und Rechtsstaatlichkeit.
Gleichzeitig brauchen wir in Krisen mehr Flexibilität: schnellere Entscheidungswege, temporäre Anpassung von Arbeitszeiten, kurzfristige Ressourcenverschiebungen. Hier kommt es darauf an, Dienstrecht und Tarifrecht so weiterzuentwickeln, dass sie in Ausnahmesituationen schneller reagieren können, ohne den Schutz der Beschäftigten zu unterlaufen. Eine resiliente Verwaltung muss digital vernetzt, fachlich breit aufgestellt und organisatorisch agil sein.
VdZ: Welchen langfristigen Einfluss wird die digitale Transformation Ihrer Einschätzung nach auf das Selbstverständnis des öffentlichen Dienstes und seiner Beschäftigten haben?
Lühr: Die digitale Transformation wird das Rollenverständnis des öffentlichen Dienstes tiefgreifend verändern. Verwaltung wird weniger als „Aktenverwaltung“ wahrgenommen werden, sondern als gestaltende, datenbasierte, bürgerorientierte Dienstleistung. Beschäftigte werden stärker projekt- und teamorientiert arbeiten, oft interdisziplinär und in Netzwerken – auch über Organisationsgrenzen hinweg.
Die klassische Hierarchie wird an Bedeutung verlieren, dafür werden Kompetenzen wie Kooperationsfähigkeit, digitale Kompetenz und Innovationsbereitschaft zentral. Für das Selbstverständnis bedeutet das: Beschäftigte sind nicht mehr nur „Sachbearbeiter:in“ im engeren Sinne, sondern Problemlöser, Gestalter und Dienstleister in einer hoch vernetzten Gesellschaft. Das ist eine große Chance – wenn wir bereit sind, Weiterbildung, Führungskultur und Organisation konsequent darauf auszurichten. Wir müssen das kreative Potenzial der Beschäftigten weiterentwickeln und natürlich auch nutzen.
Prof. Dr. Henning Lühr beim 4. ZuKo THINKTANK
🗓️ 2. September, 09:30 - 18:00 Uhr
➡️ Hier geht's zum Programm
Prof. Dr. Henning Lühr moderiert die Eröffnung des 4. ZuKo THINKTANK „Mit Frische und Elan aus der Sommerpause: Kursbestimmung für Staatsmodernisierung und Digitalisierung“.